AKTUELLES
Für viele Neuautorinnen und Autoren bedeuten Anthologien ein erstes Sprungbrett auf dem Weg zu einer nachmaligen Buchveröffentlichung. Kurzausschnitte einer Vielfalt an Genres und Geschichten, bieten auch den Leser*innen einiges an Abwechslung, Unterhaltung, ja sogar die Möglichkeit, auf diesem Weg eine neue Lieblings-Schriftstellerin oder Schriftsteller zu entdecken.

So vielfältig wie die Literatur erweist sich in der Natur der Ceiba speciosa. Er kommt in Südamerika vor und hat verschiedene Namen. Flaschenbaum, Florettseidenbaum, aber auch Toborochi (Bolivien) oder Kapok (Mexiko). Die Vorstufe der Blüten ist eine Art Baumwolle, deswegen gehört er zu den Wollbaum-Gewächsen. Seine Wolle wird teilweise zur Herstellung von Schwimmwesten verwendet, jedoch auch für feuerfeste Westen der Feuerwehr! Wenn er voll in Blüte ist mit seinem klassischen Altrosa Gewand, bringt er jeden Besucher zum Staunen und dominiert farblich für kurze Zeit seine Umwelt.
Zurzeit lesen Sie in dieser Rubrik:
Johannes Harnecker Glühwürmchen
Christian Mutzel Selenernte
Michael Kothe Heisse Weihnacht
Ronja Katharina Quentin: Träume sind auch Wege zur Realität
Doerte Krebs In Varde
Ben Berlin: Der Kofferraum
Michael Kothe: Auszug aus ..., Schmunzelmord
Sophie Kinsella: Love your Life
Michael Kothe: Die Höhle
Esther S. Schmidt: Die Chroniken der Wälder
Sophie Kinsella: Twenties Girl

»Oh where it starts it ends.« Das leise Rauschen hatte etwas Berauschendes.
Das Rotieren des Motors und das damit einhergehende Brummen innerhalb der Karosserie kapselte Tom stets von seiner Umwelt ab. Ein ganz eigenes Portal in eine andere Welt, frei von Sorgen und Nöten. Tom konnte sich darauf einlassen, es zulassen. Clean sing für die Seele. Lange Autofahrten führten bei ihm stets zu eigenen kleinen Aussetzern, in denen sein Geist ziellos durch ein schier endloses Gefilde tiefsten Jungels diffus verknüpfter Synapsen wandelte, die sich wie Lianen explosionsartig ausbreiteten. Meditative Stränge, die sich mit der Zeit aufspalteten und wahrhaftige Diskussionen untereinander zu führen schienen. Die Dreifaltigkeit in Person oder wie dieser ganze Scheiß noch genannt werden kann. Diese meditativen Momente weckten in Tom stets die Erkenntnis, dass im Endeffekt alles egal zu sein schien, allerdings nur vordergründig. Natürlich sind die Probleme, die man mit sich rumschleppt, in einem endlichen Zeitraum irrelevant, aber verändert nicht jede Unebenheit auf dem Weg den Zustand eines Wesens? Eine Theorie seiner selbst war, dass sein Inneres instinktiv immer lauter schrie als seine Umwelt, um sich selbst über die Endlichkeit des Lebens hinwegzutäuschen – wenn auch nur für den Moment. Ein rhythmischer Health Check, um zu schauen, dass auch wirklich alles in Ordnung war? Wie kann es sonst sein, dass in monoton anhaltenden Momenten syntaktische Fehlsprünge sich entladender Axiome stattfanden, die wiederum in teilweise viel zu real wirkenden Halluzinationen enden. Oder anders ausgedrückt, warum fing er immer an, in seine Tagträume abzudriften, wenn es um ihn herum laut wurde? In der Ruhe liegt die Kraft, pflegte seine Mutter stets zu sagen und er brauchte viel zu lange zu verstehen, was das wirklich bedeutet …,
während sich sein Verstand einkapselte und durch die Breiten vergangener Erinnerungen streifte, begann sich etwas zu regen. Sein Unterbewusstsein unternahm den Versuch, die Leere mit eigenen Eindrücken zu versorgen. So kam es, dass seine geistigen Fühler eine elektrisierende Wirkung erfuhren, je näher er seinem Ziel kam. Er war nicht mehr allein. Im Dschungel beobachtet, ohne zu wissen, aus welcher Richtung genau sich die Präsenz bemerkbar macht. Eine Kreatur, die sich noch nicht zeigen wollte. Das einst so laue Rauschen des seichten Verkehrs verlor mit zermürbender Ausdauer an Glanz und wurde immer mehr zu einem Dröhnen, das in den Untiefen jener Gewässer Anklang fand und sich reliefartig in die audiovisuelle Retina seines Verstands einbrannte.
Ein Stauende kam in Sicht und seine Sinne entzogen dem Unterbewusstsein langsam, aber sicher die Kontrolle. Er schaltete, doch das gleichmäßige Brummen war weiterhin zu hören. Es vermischte sich mit dem neuen Drehmoment und stimmte eine vielstimmige Ouvertüre in seinen Ohren an. Sein Magen zog sich zusammen und trieb Ausscheidungen durch sämtliche Poren, die ihn mit Ekel erfüllten wie ein zu lange liegen gebliebener Schwamm, dessen Ränder bereits hart geworden sind, obwohl er nur so vor aufgesogener Flüssigkeit zu triefen schien. Er spürte, wie sich kleine Rinnsale hauchdünner Schweißfäden ihren Weg über die stark behaarte Knöchel Richtung Handinnenfläche suchten. Aus seiner Abwesenheit heraus registrierte er allerdings auch ein tiefliegendes Drücken sämtlicher Rückenwirbel unterhalb seines Kreuzes. Ein Zurechtrücken des Autositzes bewirkte lediglich ein bestialisch klingendes Knacken, das ihn wie ein unterschwellig drückendes Hissen jener unbekannten Kreatur aus den Untiefen seines kognitiven Jungels wieder vollends in die Realität zurückholte.
Das Auto stand. Navy: »Hamburg 130 km«. Ein Blick auf die Uhr: 20:34. Er lag gut in der Zeit, dennoch machte ihn die Warterei manisch und so gönnte er seinen Augen eine kleine Auszeit, lehnte sich zurück und holte tief Luft. Ein Lächeln breitete sich auf seinen schmalen Lippen aus und zog ganz ohne sein Zutun über unsichtbaren Fäden an verdrehten Hautpartien, welche sich momentan noch mühelos der Schwerkraft widersetzten. Er lächelte, doch seine Augen strahlten eine Wildheit aus. Einer Wildheit, der er sich allzu bald gegenüber sehen sollte.
Dr. Kai Schummer war die nächsten zwei Stunden mit dem Herrichten des Leichnams beschäftigt. Wenig später hörte er Schritte auf dem Gang. Durch die kleine Luke innerhalb der Tür konnte er den langen Korridor komplett einsehen. Er beobachtete den hochgewachsenen Mann, der sich am Fuße der Treppe am anderen Ende anhand ausgehängter Schilder orientierte und anschließend zielstrebig in seine Richtung schritt. Die Kaffeemaschine gab ihr vertrautes Piepen von sich, doch Schummer konnte seinen Blick nicht lösen. Die Zeit schien sich zu verlangsamen. Die letzten Strahlen einer purpurnen Sonne fanden ihren Weg durch das hinter dem Mann verbauten Treppenhauses und erleuchteten ihn von schräg oben, sodass sämtliche Fussel seines abgetragenen Mantels in ein goldrötliches Licht getunkt wurden und dadurch die Illusion eines glimmenden Schimmers erzeugten.
Sämtliche Konturen seiner Statur wurden hervorgehoben, wobei sein Gesicht jedoch in fast völliger Dunkelheit lag. Als er sich nun in Bewegung setzte, flackerte die spärliche Beleuchtung im Takt seiner Schritte und warf weite Schatten in ein Gesicht, das die tief liegenden Augenhöhlen wie zwei Krater in wankenden Bewegungen zweier in elliptischen Bahnen kreisenden Monden versetzten. Der Kopf war fast komplett kahlgeschoren und gab eine streng verzogene Kopfpartie preis, die in ihrer Unebenheit einem Trümmerfeld glich und durch jahrelangen Nikotinkonsum gezeichnet worden schien. Am Hals traten zerrende Sehnen stark hervor und erinnerten in Kombination der quirlenden Adern an Schläfen und Stirn an eine Garnitur einer ernsten, strengen, aber auch verschwiegenen Persönlichkeit. Doch irgendetwas stimmte nicht. Die Luft begann sich noch schwerer anzufühlen und ein leises Summen erfüllte Schummers Ohren. Die Schachtel Zigaretten in seiner Manteltasche schienen seine Sucht regelrecht zu höhnen und er verwünschte den Ankömmling wegen der verpassten Raucherpause. Schummer griff nach der Kaffeetasse und verbrannte sich direkt beim ersten Schluck ..., was ein Tag heute. Es klopfte an der Tür. Und mit jedem Schlag zuckte Schummer ein kleines bisschen zusammen. Seine Trommelfelle fühlten sich gereizt an, und er hörte irgendwie schlechter als sonst. »Mann, oh Mann, du hast dir wohl wieder irgendwo was eingefangen.«
Mit einer Handbewegung winkte er den Ankömmling herein und war überrascht. Der Mann war bestimmt Mitte dreißig und damit viel zu alt, als dass er der Sohn des Verstorbenen hätte sein können.
»Ja, kann ich ihnen helfen?«
»Ich hatte angerufen ... Der Leichnam meines Vaters liegt hier. Trauber mein Name.«
»Ah, gut, können Sie sich ausweisen? Ausweis, Führerschein? Reisepass würde zur Not auch gehen.«
Tom kramte in seiner Hosentasche und fischte mit ungelenkiger Bewegung seinen Personalausweis heraus. Schummer warf einen Blick darauf, musterte ihn und nickte. Ein weiterer kurzer Blick bestätigte seine Vermutung, dieser Mann war 34 Jahre alt.
»Haben Sie den Ausweis ihres Vaters, wie am Telefon besprochen, finden können?« Hatte er schon wieder vergessen, die Heizung am Abend vorher runterzudrehen? Gefühlt war es jedenfalls eine Bullenhitze hier. Sein Gegenüber wirkte relativ angespannt. Schummer sah herabhängende Schweißtropfen an den hervortretenden Adern, die im bläulichen Licht des Saals regelrecht pulsierten und an den tief eingefallenen Augenhöhlen an Tropfstein erinnerten.
Tom verharrte kurz in seiner Bewegung, griff dann jedoch ein weiteres Mal in sein Portemonnaie und gab Schummer das dünne Stück Plastik. Dabei fühlte er sich mit einem Mal unwohl. Er hatte einen dicken Kloss im Hals, ohne zu wissen woher.
»Martin Trauber, Geburtsdatum 07.09.1951.« Schummer blickte demonstrativ noch einmal auf den bisher verschlossenen Leichensack. »Der ist keine 70...«
»Mein Vater war einer der 100.000 Geimpften. Seit seinem dreißigsten Geburtstag ist er nicht mehr gealtert. Ich habe zur Bestätigung auch die Akten mitgebracht.« Der leicht gereizte Ausdruck Schummers wich dezentem Erstaunen. Das Krankenhaus befand sich in einem Reichenviertel und so hatte er schon öfters mit geimpften Patienten zu tun gehabt.
»Ach, tatsächlich, kann ich mal sehen?« Tom gab ihm die Akten, die er aus einer gepflegten Aktentasche holte. Schummer überflog sie und nickte erneut.
»In Ordnung. Kommen Sie.« Die beiden Männer gingen zum Kopfende des Tisches und Schummer öffnete den Reißverschluss des Leichensacks. Als er kurz mit dem Daumen an der Nasenspitze des Toten hängen blieb, durchfuhr ihn ein Zwicken, das einem leichten Stromschlag glich. Außerdem hörte er ein Ploppen in den Ohren, das ihn sehr an den Druckausgleich im Flugzeug erinnerte. Überrascht schaute er nach unten, ohne zu erkennen, woher dies gekommen war.
»Na ja, dann lasse ich Sie mal alleine, wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf diesen Knopf hier und ich werde benachrichtigt.« Doch der Mann schien dies gar nicht mehr wahrzunehmen. Auch gut, er wollte sowieso nur noch weg.
»Rechtsmedizin – Mittelgang«. Er schaute den Gang hinunter – ein dezentes bläuliches Glimmen der spärlichen Beleuchtung spiegelte sich auf den leicht gewellten Wänden wider, die trotz ihres für eine Klinik typischen weißen Putzes unter dem Gewicht des darüber liegenden Gebäudes zu ächzen schienen. Zumindest im Eingangsbereich hatte er noch dieses makellose Aussehen, doch je weiter man sich vom Eingangsbereich entfernte, desto schäbiger wurde es. Toms schweifender Blick stellte jedoch mit unfokussierter Gewissheit eine Ähnlichkeit zu durch Thromben zersetzten und durch Venenschwäche gekennzeichnete Gliedmaßen fest. Auf den ersten Blick wirkte alles in Ordnung, bei näherem Hinsehen runzelt der Arzt die Stirn und ruft seine Assistentin, „Charleen, holen Sie doch bitte einmal Dr. Gabelhauser.“ Doch sein Blick sagt bereits alles.
Tom blickt, drang tiefer in die Katakomben ein. Ein Blick durch eine Sonde auf ihrem Weg durch die Innereien eines bettlägerigen Riesen ohne adäquate Behandlung. Je tiefer er schaute, desto schlimmer wurden die Ausprägungen, die sich am schier endlos weit entfernten Ende in ein Gewucher aus Ranken, Wülsten und Platzwunden eines sich ausbreitenden Organismus aufzulösen schienen.
Tom hielt sich einen Moment am Handlauf fest und schüttelte entnervt seinen Kopf. Mein Gott, jetzt reiß dich mal zusammen. Er hob den Kopf und der Gang baute sich geradlinig vor ihm auf. Im Hintergrund flackerte eine kaputte Neonröhre, ansonsten war alles ruhig.
Bildete er sich das nur ein, oder bewegten sich die blauen Streifen der Reflexionen? Das Licht war zu dimm, als dass er es mit Gewissheit sagen konnte, dennoch musste schlagartig an etwaige Besuche beim damals ansässigen Aquarium denken. Es hatte einen unterirdischen Gang einmal quer durchs größte Becken, Tom war jedoch noch zu klein gewesen, um eigenständig über den Rand des festen Betonfundaments hinwegschauen zu können. Stattdessen betrachtete er die abgerundete Kuppel, welche die trennende Barriere zwischen ihm und den wilden Gewässern bildete. In seiner kindlichen Fantasie ein Himmelszelt, das sich wie der Spalte eines Canyons über ihm erhob. Um ihn herum staunten die Menschen, sieh mal hier …, der hat aber große Flossen. Oh, ist der schnell …, aber Tom hatte nur Sinn für die sich überschlagenden Lichteinfälle, die sich in einem harmonischen Muster an der Wand ausbreiteten und kontinuierlich übereinander herfielen und so einen Schwarm ineinander sinkende Lichtblitze auf die Welt losließen. Seine ganz private Lichtshow, an einer riesigen Leinwand. Wie, wenn sein Opa ihn zum Zirkus mitnahm und der Feuerspeier sein Kunststück vorführte. Das letzte Mal saßen sie so weit vorn, dass er die Hitzewelle spüren konnte und sich aktiv wegdrehen musste, damit seine Augen nicht austrockneten, wie Eddie immer sagte. In diesem Moment konnte er das Schattenspiel an der bunten Fassade des Zeltes sehen und fragte sich, wie es wohl von draußen aussieht. Sein Kumpel Eddie meinte, er wäre noch nie in einem Zirkus gewesen. Niemand spuckt Feuer, das ist alles nur ein Trick für Pappnasen. Aber war genau nicht das der Sinn dahinter? Zu wissen, dass alles nur Show ist, und sich trotzdem berieseln zu lassen. Der Mann da vorne konnte natürlich Feuer spucken, sein Opa bückte sich zu ihm herunter – denn er war in einem früheren Leben einmal ein Drache gewesen. Toms Kulleraugen folgten dem leicht verzerrtem Schatten vom Petroleumderivats des Feuerspuckers auf der Zeltplane und verschmolzen in seiner Erinnerung mit den sich überschlagenden Lichtstrahlen des gerade in Aufruhr gekommenen Aquariums. Die Zeltplane war in dem Moment genauso durchsichtig wie das Glas über seinem Kopf und er sah etwas dahinter glimmen.
Was er beim letzten Feuerstoß, dem sich anbahnenden Schatten im Aquarium und dem Hinunterblicken des peinlich penibel polierten Krankenhauseingangs empfand, war ein und dasselbe.
Tom setzte sich in Bewegung. Ein gequältes Gemurmel hatte sich mittlerweile zu dem mit beachtlicher Lautstärke angeschwollenen Rauschen dazu gesellt. Tom hörte genauer hin, vor seinem geistigen Auge erschien wieder das Bild eines Urwalds, dessen Bewohner allerdings ganz still wurden. Der Wald versuchte seine Ranken ein paar Zentimeter tiefer im Boden zu verankern, um sich gegen den Erstschlag zu wappnen. Nur noch ein kleines Stück, wie ein betrunkener Teenager auf einer misslingenden Heimfahrt im letzten Moment doch noch versucht, den Sicherheitsgurt irgendwie in die Schnalle zu bekommen, ehe seine Lungenflügel durch gebrochene Rippen punktiert werden. Es wird ganz still, lediglich ein Rascheln verzweifelter trippelnder Pfoten, durchsetzte das Ambiente, bevor das Erdbeben den Boden in Stücke riss. Tom setzt einen Fuß vor den anderen, er schmeckte den bitteren Nachgeschmack seines eigenen Blutes, das seinen Schädel in schwerfälligen Wogen durchfuhr und ihn über mikroskopisch kleine Schnitte am Rachen kitzelte – ihn stets an die ausbreitende Taubheit seiner Nasennebenhöhlen erinnerte. Es miefte hier unten.
Während er seinen schwerfälligen Gang fortsetzte, versuchte er das Gemurmel einzuordnen. Ein wiederholendes Stöhnen, dessen rumorenden Tiefen nur von einer größeren Kreatur entstammen konnten. Es klammerte sich an Tom, und durchfuhr seinen gesamten Körper, indem es sich erst vom Zwerchfell über den Kehlkopf ausbreitete, an ihm zerrte, bis die Lungenflügel zu zittern begannen. Tom schüttelte seinen Kopf, schloss krampfhaft die Augen und drückte sie so fest zusammen, dass sie zu tränen begannen. Als er sie wieder öffnete, sah er keine Wände mehr. Die Wände und der Boden waren aus Glas, umgeben von blauem Nebel konnte er sein Ziel erkennen und setzte sich nun noch schneller in Bewegung.
Das Gemurmel schwoll beim Aufprall seiner Absätze an. Er verfiel in einen regelrechten Laufschritt, wobei seine Absätze zuerst feine Risse, dann allerdings immer schwerwiegendere Male im Glas hinterließen. Mit jedem Riss durchbrachen neue Geräusche die dämmende Barriere, das Gemurmel wurde lauter und schwoll teilweise zu einer leibhaftigen Schrei-Arie an. Seine Ohren hatten vor Stunden dem Druck nachgegeben und Tom konnte einzelne Töne ausmachen, die in bestimmten Frequenzen nachhalten und in seinem Kopf verschiedenste Assoziationen hervorriefen. Mit jedem zurückgelegten Schritt lichtete sich der Nebel hinter den Scheiben etwas mehr und er sah eine riesige Grünfläche. Er schaute auf eine Lichtung, auf der sich eine Kreatur wand. Sie hatte sich unter enormen Blättern einer ihm unbekannten Baumart verkrochen. Schmerzen schienen sich hier auf allen Frequenzen zu manifestieren und das Bündel hob und senkte sich in arrhythmischen Zyklen auf und ab. An der Unterseite der Blätter hatten sich bereits ausgebreitete Rinnsale gebildet, die in dickflüssigen Tropfen wie Kautschuk von den Blättern auf den Boden trieften.
»Ja, kann ich Ihnen helfen?« Tom stand vor dem Arzt.
»Ich hatte angerufen ..., der Leichnam meines Vaters liegt hier. Trauber mein Name.« Tom öffnete die Tür und ihm schlug eine Hitze entgegen, die bei ihm einen sofortigen Schweißausbruch verursachte. Er befand sich in einem florierenden Dickicht ineinander verwobener Ranken einer sprießenden Flora. Die Lichtung erstrahlte in einem sehr hellen Licht wie eine in tiefes Scheinwerferlicht gehüllte Bühne. Er trat ein.
»Ah, gut, können Sie sich ausweisen? Ausweis, Führerschein ...« Die Strahlen einer am Zenit stehenden Sonne prallten von Perlen eines schwitzenden Waldes ab und verfolgten Tom regelrecht wie Scheinwerferlicht. Die Regentropfen bildeten nicht nur einen schützenden Film über die Wucherungen, sondern agierten auch als Prismen, welche die eintreffenden Strahlen in ihre Spektren zerlegten, wobei die unterschiedlichen Bereiche der Lichtung so in verschiedenste Farbspektren eines Regenbogens aufgeteilt wurden. Tom staunte, er hatte so etwas noch nie gesehen. Wolken verschiedenster Farbräume, versuchten ihre Griffe in seiner Realität zu manifestieren. Sie breiteten sich aus, und er sah das Bündel Blätter pulsieren als es sich in einem schneller werdenden Rhythmus hob und wieder absenkte.
»Mein Vater war einer der 100.000 Geimpften. Seit seinem dreißigsten Geburtstag ist er nicht mehr gealtert. Ich habe zur Bestätigung auch die Akten ...« Es wurde wieder still. Eine Bombe, die einschlug, ein Atompilz, der sich bildete und erst implodierte, bevor sich die Verwüstung durch alles fraß, was es zwischen die Finger bekommen konnte. Tom atmete aus und starrte den Arzt an.
»In Ordnung. Kommen Sie.« Sie gingen zum Leichensack und tatsächlich, er konnte die bunten Gewitterwolken spüren. Sie durchzogen den Raum und als der Mann am Reißverschluss des Sackes zog, entlud sich die gestaute Energie. Ein ohrenbetäubender Knall durchdrang den Saal und Tom spürte, wie sein rechtes Trommelfell platzte.
»Na ja, dann lasse ich Sie mal alleine, wenn Sie fertig sind ...«
Tom stand wieder auf der weiten Lichtung, sie waren endlich alleine. Das oberste Blatt war heruntergerutscht und zum Vorschein kam ein geschlossenes Scheitelauge einer Kreatur, die etwa doppelt zu groß zu sein schien wie Tom. Es öffnete sich einen Spalt breit und er starrte in einen pechschwarzen Iris losen Abgrund, dem jegliche Güte mit der Zeit entfallen war.
»Hallo Martin ... Vater.« Das Auge schloss sich langsam und neben dem Schweifen aneinander reibender Hautpartien hörte er ein tiefes Röhren, das sich eher wie ein Knarzen eines Baumes anhörte, der mit letzter Mühe versucht stehen zu bleiben oder wie Gaffer Tape, das mit einer zu langsamen Bewegung von der Rolle abgezogen wird.
»Sieh mich an!« Keine Reaktion. »Nach allem, was du getan hast, SIEH MICH AN!«
Tom begann den Berg aus Fleisch zu besteigen, wobei er von einzelnen blutgetränkten Blättern abrutschte. Seine Schuhe blieben mehrfach in diversen Wunden stecken, doch er interessierte sich nur für die Augen. Oben angekommen setzte er sein komplettes Körpergewicht dazu ein, den Kopf des Wesens gen Boden zu befördern und dort zu befestigen, indem er mehrere Karabiner durch dessen Schlund trieb, die den Körper wie festgenagelt an Ort und Stelle hielten. Der Leib wand sich unter seinem Gewicht, war jedoch nicht in der Lage ihn abzuschütteln, und verlor mit jeder weiteren Bewegung an Kraft. Zu guter Letzt entfernte Tom die Augenlider.
Tom setzte sich vor der Kreatur auf die Wiese, wobei ihn die buschigen Enden des umliegenden Pampasgrases den Nacken kitzelte, oder waren das doch wieder nur die eigenen Nerven?
Er hatte lange darüber nachgedacht, was er als Nächstes tun sollte. Die richtigen Worte zu finden, fiel ihm schon immer schwer, er hatte sich eine ganze Rede zurechtgelegt, Anschuldigung, die nur den richtigen Tonus brauchten, um den gewünschten Zweck zu erfüllen. Doch wo er nun in die Tiefen seines Gegenübers sehen konnte, fiel es ihm allerdings so einfach. Das eigene Spiegelbild verschmolz mit seinen Gedanken.
Er hörte ihre Stimme. »Weißt du, warum Glühwürmchen glühen?«
»Wofür bezahlen wir eigentlich Steuern? Nicht mehr lange und man bleibt stecken.« Sein Vater drehte sich in seiner charakteristischen Geste zu ihm um, bei der die freie Hand stets auf dem Rücken des Beifahrersitzes platziert zu sein hat. Nachdem der Motor erneut aufjaulte, gab er mehr Gas, um das Hinterteil des Wagens aus einem Schlagloch besorgniserregender Größe zu befördern. In gekonnten Schlangenlinien setzte er dabei noch etwas zurück, um die Schnauze des Kombis endgültig aus der Einfahrt ihres kleinen Einfamilienhauses zu befreien, ohne dabei die Vorderseite ebenfalls abzusenken. Er zwinkerte dem kleinen Tom zu, ohne auf Toms Mutter zu achten, die lediglich einen ihrer ganz eigenen Schnauflaut von sich gab, wodurch sein Lächeln allerdings erstarrte. Die dabei schief angezogene Nase, die Tom aus seiner tiefergelegten Perspektive stets an die Nüstern eines wiehernden Pferdes erinnerten, blähte sich auf, als sein Vater mit erstaunlicher Ähnlichkeit zum Getriebe ihres damals brandneuen Polos einen Laut von sich ließ, der versuchte ein röhrendes Lachen zu imitieren. Als sein Vater anschließend endlich den Gang einlegte, erkannte Tom in den kleinen Fältchen, die sich in konzentrischen Ovalen um die Augen ausbreiteten, einen tief verwurzelten Schatten.
Tom lachte nicht. Damals hatte sich die Fuge zwischen den Augenbrauen noch nicht gebildet, die ihn in späteren Jahren mit befehlendem Ton herausforderten, selbst wenn die Worte ihren vertraut verschmitzten Klang nie verloren. Doch seine Augen hatten stets etwas Suchendes. Eine Unterhaltung wurde nicht nur gehalten, sie wurde geführt. Es war stets ein Turnier sich aufbrausender Gewalten, die wie Lanzen versuchten den Gegner zu Fall zu bringen. In späteren Jahren erkannte Tom, warum sein Vater ein solch erfolgreicher Investor gewesen war. Der klare Blick durchdrang das Gegenüber in einer Weise, bei der das Opfer in einem unsichtbaren Käfig gefangen war. Jeder Ausbruchsversuch wurde im letzten Moment mit einem Konter direkt im Keim erstickt. Und er konnte erahnen, in welche Richtung sich eine Auseinandersetzung entwickelte, lange bevor man sich selbst darüber im Klaren war.
Doch nun waren seine Augen glasig und hatten all ihren Glanz verloren. Durchsetzt mit Äderchen und geweiteten Pupillen musterten sie gleichgültig die breite Straße und fuhren mit einer Gelassenheit, die keinerlei Störungen duldete, über die vorbei brausende Szenerie der umliegenden Felder der Autobahn hinweg. Die gute Laune seines Vaters und die damit einhergehenden Dämpfe, die ihn an solchen Tagen stets umgaben, führte dazu, dass Toms Nase bereits in frühesten Kinderjahren die verschiedensten Sorten Alkohols nur anhand ihres Geruchs voneinander unterscheiden konnte.
Als sich ein Stauende vor der Biegung der nächsten Anhöhe abzeichnete, vernahm er ein Schnaufen in dessen Zuge eine dezent stinkende Duftwolke durch den Raum waberte. An sie klammerte sich in verzweifelter Manier ein fadenscheiniges Gewebe hysterisch klingender Stimmen, die in Toms Synapsen wieder das allseits bekannte Gewitter für ihn unzusammenhängender Gedanken auslösten. Sie schrien Tom förmlich an. »Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen!« Es war als hätte ein gefallener Engel versucht ihn doch noch zu retten, doch es war bereits zu spät. Tom spürte auf einmal, dass sie nicht mehr zu dritt im Auto saßen. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, böse, kalt und unermüdlich. Sein Herz setzte einen Schlag aus, als sein Vater ihn über den Rückspiegel musterte und ihm erneut zuzwinkerte.
»Wenn die Glühwürmchen schlüpfen, dann machen sie ein Feuer, ein Feuer, das sie erfüllt und jede Faser ihres Wesens mit einer Intensität durchstrahlt, die jede Glühbirne zu bersten bringen würde. Ein Feuer, das ihre Welt erleuchtet und auf ihre Umwelt abfärbt, kurz bevor sie sich der ewigen Ruhe hingeben. Genau wie du.« Sie stupste dem Säugling auf die kleine, in ruhigen Zyklen schnaufenden Nase. Er rekelte sich und schaute mit großen Augen hinauf, in ihre Augen, an deren Farbe er sich nicht mehr erinnern konnte. In seiner Erinnerung hielt dieser Moment lange an und so entstand in der Reflexion ein Feuerwerk, das ihre Pupillen in Farben einer tiefer liegenden Sphäre tunkte, durch die ein Mensch eigentlich nicht schauen konnte. Genau wie ihre tief liegenden Falten, die im untergehenden Sonnenlicht wie Fjorde im goldenen Glanz einer rötlich glühenden Sonne aufleuchten. Einst stark hervortretender Tränensäcke hingen wie Ballons einer Wetterstation über dem untergehenden Land. Auch sie schienen zu brennen und gruben sich tief in das Bewusstsein ein – ja er brannte, und konnte nur erahnen, wie er in Zukunft brennen wird.
Der Verkehr begann sich langsam in Bewegung zu setzen und fuhr über das Land wie eine träge fallende Lawine metallenen Einheitsbreis.
»Fahr doch endlich, du verdammter Hurensohn.«
»Mensch Martin, muss das sein«. Seine Mutter verdrehte die Augen und starrte stur nach vorn.
»Aber sieh doch, wieso haben solche Leute überhaupt einen Lappen? Mein Gott«.
»Jetzt hör doch endlich ...« Doch Tom hörte nicht mehr hin. Seit dem letzten Stau hatte sich die Panik regelrecht in ihm festgesetzt. Sie betäubte ihn und drückte ihm die Luft ab. Sämtliche Schlagadern zogen sich mit pulsierenden Fäden über seine Kopfhaut und gruben ihre gierigen Finger in sein Fleisch. Toms Sinne kapselten sich ab und nahmen nur noch den eigenen kleinen Mikrokosmos wahr. Seine Stirnhöhle wurde wie ein zu lau aufgeblasener Ballon, der einfach nicht platzen wollte, hin und her gequetscht. Sein Kopf dröhnte und er fühlte, wie sich sämtliche Kapillaren seines noch so kleinen Körpers zusammenzogen und versuchten, Herr der Lage zu werden. Was passiert hier?
»Die Tür, du musst sie nur öffnen.« Doch sie fuhren auf der Überholspur in atemberaubender Geschwindigkeit. »Nein, niemals.« Er begann sich zu regen, seine Starre fing an sich zu lösen und Tränen der Verzweiflung rannen ihm über das Gesicht. Ein Hissen durchfuhr den Raum. »Da, die Lücke da vorne«, doch niemand sonst schien es gehört zu haben. Oder? Die Augen seines Vaters begannen zu wandern. Seine Mutter blickte völlig entnervt in den Seitenspiegel und drehte sich um als sie das leise Schluchzen vernahm.
»Ist alles gut, mein ...«. Doch es ging alles so schnell. Toms Pupillen weiteten sich. Er sah seinen Vater, oder so glaubte er zumindest, denn eng um ihn gerungen hatte die Luft zu vibrieren begonnen, sich zusammengezogen und in Strängen die Augen seines Vaters penetriert. Ein Aufschrei blanker Wut und der Wagen machte einen Satz nach vorn. Er versuchte sich auf die rechte Spur einzufädeln, um den Wagen vor ihnen zu überholen, doch durch die ruckartige Bewegung kam der Wagen ins Schlingern. Tom und seine Mutter begannen zu schreien und auf einmal, war es nur noch Tom der schrie.
Dr. Schummer betrat das Zimmer und sah Tom mit tränenden Augen vornübergebeugt über dem Leichnam verweilen.
»Wieso haben Sie denn seine Augen geöffnet?«
Tom reagierte nicht darauf. »Ist es möglich, der Einäscherung beizuwohnen?« Perplex starrte Schummer ihn an.
»Tendenziell spricht erst einmal nichts dagegen. Es dauert allerdings noch eine Weile, bis der Ofen das nächste Mal in Betrieb genommen wird.«
»Ich habe Zeit.«
Tom saß wieder vor der Kreatur. In der Ferne sah er bereits dicke Rauchschwaden, deren Qualm dem Horizont jeglichen Glanz nahm. Mittlerweile bedeckten fast gar keine Blätter mehr ihr Haupt und stellte so eine zerfetzte Fassade eines einst mächtigen Körpers zur Schau. Amüsiert dachte er an gestrandete Tiefseefische. Solche, die unter dem fehlenden Wasserdruck aufblähen und nur noch ein aufgedunsener, plumper in sich zusammenfallender Klumpen Fleisch ohne Rückgrat darstellen, dessen Halbwertszeit längst überschritten war – ein Schatten ihrer selbst. Aus den Ausbuchtungen sprossen verschiedenste Extremitäten, die in allerlei unnatürlichen Winkeln herausragten und ihn in gewisser Weise an Arme und Beine erinnerten. Hier im breiten Licht der Lichtung wirkten sie allerdings eher wie nutzlose Ausprägungen einer Spezies, an der die Evolution scheinbar vorübergegangen war. Die übereinander herfallenden Fettschichten rieben derart stark aneinander, dass sich über feine Risse stoßweise in kleinen Fontänen dunkles Blut über das Geschöpf ergoss. Tom dachte an die Wasserbomben, mit denen sie sich als Kinder bekriegt haben und an beschädigte Blindgänger, die nicht platzen wollten.
Die Luft wurde bereits merklich stickiger und er roch den beißenden Hauch von Ruß und Rauch. Das Sichtfeld verkleinerte sich ebenfalls, dieses Mal allerdings nicht durch den Nebel. Tom drehte sich weg und betrachtete zum ersten Mal die Lichtung im Detail. Ein kleiner Bach durchzog die Landschaft. In der Ferne konnte er ein leises Rauschen ausmachen, das größere Wassermassen ankündigte, hier jedoch plätscherte er gemächlich dahin. Mit der Zeit gewann er seinen Gehörsinn zumindest in Teilen wieder zurück, und konnte verschiedenste Laute des Tierreichs ausmachen. Angefangen vom Kreischen rivalisierender Gruppen aggressiv klingender Primaten, welche sich mithilfe diverser Schlingpflanzen fortbewegten, bis hin zu Vögeln, die mit ihrem Schnattern und Trommeln versuchten Bäume zum Einsturz zu bringen. Das buschige Ende der Sträucher um ihn herum kitzelte seine Handinnenflächen als er mit betrübter Miene seine Finger durch die Stauden fuhr. Er hörte das Rascheln und die leichte Brise, welche die Szenerie um ihn herum in einen schweifend lang gezogenen Ton vertrauter Stille trieb. Er setzte sich auf, es war zu still. Das Tier vor seinen Füßen begann einen tiefen kehlkopfartigen Laut von sich zu geben, der Tom durchs Mark ging.
Ein Lächeln gepaart mit einem Stirnrunzeln setzte sich auf sein Gesicht, als er das sich windenden Tier betrachtete. Er spürt die unaufhaltsame Kraft einer sich langsam aber stetig voran arbeitenden Dampfwalze, die ihre züngelnden Griffel über das umliegende Land erstreckte.
»Ich habe eine Überraschung für dich.« Und Tom fiel wieder in die großen, verzweifelten Augen.
Das Feuer erreichte die Lichtung wie ein altvertrauter Freund und bäumte sich zu einer meterhohen Feuerwand auf, die sich an herunterhängen Ranken hochzog und sie einhüllte.
»Ich weiß, du kannst nicht sterben. Aber zu welchem Preis? Das alles hier passiert nur in deinem Kopf, da drinnen.« Er klatschte mit der offenen Handfläche auf das geöffnete Auge der Kreatur.
Die Hitze drückte und glich einem feurigen Inferno.
»Was ich für dich vorbereitet habe, wirst du dir nicht ausmalen können. Ich werde dich brechen.« Die Funken tanzten und Tom fing Feuer, ein letzter Blick in die Augen der Kreatur und er sah sein Spiegelbild. Langsam schlossen sich seine Augen, mit verschwommenem Blick und hämmerndem Kopf stellte er perplex fest, dass die Funken in einer gleichbleibenden Sequenz an Intensität gewannen und so den Eindruck eines pulsierenden Schwarms vermittelten. Er sah die Welt durch die Augen jener Kreatur, die er sich geschworen hatte, nie zu werden. Das Lächeln erlosch und er ließ er sich fallen.
»Ich kann die Glühwürmchen in deinen Augen sehen.« Und tatsächlich, die Funken pulsierte zu einer Melodie.
Epilog
Als kleiner Junge zählten die Abende beim Bootshaus zu den schönsten Momenten des Sommers. Sie erwiesen sich später auch immer wieder als Ankerpunkt für etwaige Therapien. Denn jeder braucht seinen Ground Zero, etwas wofür es sich zu kämpfen lohnt, etwas woran man seine eigene Sterblichkeit messen kann. Wo er sich nach dem Unfall im durch den Verkehr windenden Krankenwagen befand und die Schockstarre für einen Moment nachließ, dachte er genau daran, während sich das Blaulicht mit blauen Pfeilspitzen in sein Gedächtnis einbrannte.
»Denn Glühwürmchen glühen bedingungslos. Sie haben keine Fassung wie Lampen, die beim Stromausfall einfach erlöschen. Einmal angefangen, bringen sie es zu Ende. Hörst du sie?« Sie saßen auf einer breiten Veranda umgeben vom Schilf ihres Bootshauses. Und tatsächlich, er hörte sie. Sie blinkten, strahlten im Takt einer schlagenden Melodie. Und wieder lächelten ihre Augen.
ENDE
CHRISTIAN MUTZEL

Christian Mutzel wurde am 01.04.1990 in Schwandorf, in der Oberpfalz, geboren. Sein betriebswirtschaftliches Studi-um mit der Vertiefung Mar-keting schloss er an der Fachhochschule Ansbach mit dem Bachelor of Arts ab. Seit 2016 ist er in einer Online-Marketing-Agentur als Content Marketing Manager und Texter tätig. Mit seiner Leidenschaft für das Schreiben gelangen ihm bislang Veröffentlichungen von Kurzgeschichten in verschie-denen Anthologien. Außerdem führt er seinen eigenen Blog. Der erste Roman ist in Arbeit. Besuchen Sie ihn auch auf seiner Webseite:
Hier ist seine Geschichte:
Seelenernte
(Urheberrechte & Copyrights © by Christian Mutzel)
Er hatte es getan. Ungläubig und zitternd starrte Henry auf seine blutbeschmierten Hände. Den Stein, mit dem er die Tat vollbracht hatte, hielt er noch immer verkrampft fest. Heiße Glut schoss durch seine Adern und sein Atem war wie eine schwer arbeitende Dampfmaschine. Er hatte ihn getötet. Es war noch alles so unwirklich, wie ein luzider Traum. Doch nachdem Henry eine halbe Ewigkeit fassungslos und ohne Regung inmitten der vom Frost bedeckten Gräser gesessen hatte, schaffte es sein Verstand allmählich, sich aus dem dichten Nebel hervor zu tasten, der seine Gedanken blockierte. Die Realität schließlich anerkennend wisperte er heißer vor sich hin: „Es ist wirklich. Ich habe ihn getötet.“ Mit geweiteten Augen musterte er den Leichnam, von dessen Kopf scharlachrote Rinnsale sich in alle Richtungen ausbreitete. Inmitten der weißen Weiten hoben sie sich selbst im fahlen Dämmerlicht noch deutlich ab und waren gut erkennbar. Zuerst war es etwas Schuld, die in ihm aufkam, der Anflug des Gewissens, das der Mensch wohl nie vollkommen ausstellen konnte.
„Ich habe ihn getötet“, wiederholte der Mann mit dem zerzausten Haar, der mit viel zu kühler Kleidung unterwegs war und nun spürte, wie die Kälte seine Finger taub machte. Er ließ die Tatwaffe fallen und rieb sich die Hände etwas aneinander, um das kalte Brennen zu vertreiben. Aufgeregt blickte er sich umher. Hatte ihn jemand beobachtet? Es war wohl unwahrscheinlich. Er lauschte gegen das sanfte Säuseln des Windes. Kein weiteres Geräusch.
„Ich habe ihn getötet“, verkündete er für sich ein drittes Mal, wobei seine Gesichtslähmung brach und sich seine Mundwinkel zu einem irrsinnigen
Lächeln verzogen. Ein Anklang von Euphorie lag in seiner Stimme. Henry verspürte, wie ihn die Gewissheit des Sieges überkam, Triumph Fanfaren spielten nur für ihn alleine. Er hätte am liebsten
voller Inbrunst gejubelt, doch soweit hatte sich sein katatonischer Zustand wieder gelegt, als dass er sich dazu hinreisen ließ, in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit zu erregen. Auch wenn es
ausgeschlossen war, dass an diesem abgelegenen Ort zu dieser Stunde noch jemand unterwegs war, so wollte er kein Risiko eingehen.
„Ach mein lieber
Jonas“, seufzte Henry, als er in den leeren Augen des Toten versank. „Es hätte nicht so enden müssen. Aber warum musstest du dich an meiner Frau vergehen?“ Sie würde es auch noch bezahlen, das
hatte er sich geschworen, doch im Gegensatz zu seinem Bruder wollte Henry das verräterische Flittchen nicht so einfach mit einem schnellen Tod davonkommen lassen. Sie sollte leiden, aber dafür
brauchte es etwas mehr Planung. Allein der Umstand, dass die beiden Brüder regelmäßig zusammen auf die Jagd gingen, bot die Möglichkeit, die Bluttat dezent zu begehen. Und kein Ort war besser
geeignet als dieser, wo sich kaum jemand her verirrte. In der Nähe gab es einen kleinen Spalt von dem aus ein Schacht fast senkrecht in unbekannte Tiefen
führte. Eine Höhle, die fatal war für unaufmerksame Spaziergänger – und das ideale Versteck für eine Leiche. Sie war nicht weit weg von hier. Ein bisschen müsste er den Körper ziehen, die
Schleifspuren hinterher beseitigen. Henry rappelte sich auf und wollte gerade nach dem Leib des Ermordeten greifen, als er aus den
Augenwinkeln ein Licht wahrnahm. Es bewegte sich mit gemächlicher Geschwindigkeit und kam aus dem Waldstück der alten Landstraße, das unterhalb des Berges verlief, auf dessen Gipfel die Lichtung
war, auf der er sich befand und die auch hier oben von Bäumen umsäumt war.
Es war eindeutig ein Auto. Es schien, abzubremsen. Henry sah angestrengt hinab. Ja, es bremste tatsächlich, fuhr rechts an den Rand und hielt am
Acker.
„Zum Teufel“, fluchte Henry und ging in die Hocke. Es war zwar schon relativ dunkel, doch von den Lichtverhältnissen so, dass man seine Silhouette aus dieser Distanz gerade noch erkennen konnte. Womöglich hielt er nur kurz an, um seine Position zu prüfen. Wer sonst, als jemand, der sich verfuhr, sollte diese Straße, die in den letzten Jahren durch etliche Abkürzungen obsolet wurde, passieren? Es bliebt nichts Anderes übrig: kurz ausharren, dann weitermachen. Den schmalen Pfad in das Dickicht, in dem Henry sein Auto geparkt hatte, hatte der Wagen auf jeden Fall schon hinter sich gelassen. Keine Gefahr also, dass er entdeckt werden würde.
Doch es kam etwas anders, als erwartet. Scheinbar stieg aus dem Auto jemand aus, es war mit dem blanken Auge nicht ersichtlich. Henry kramte aus
seiner Jagdtasche sein Nachtsichtfernglas hervor und blickte hindurch. Tatsächlich. Es war ein Mann, der das Auto verließ und quer über das Feld ging. Was er dort nur machte? Wahrscheinlich nur
eine Erleichterung, dachte sich Henry. Doch der Mann ging weiter und weiter. Schließlich hielt er an und blieb still. Mehr machte er nicht, außer dazustehen. Wenn Henry raten müsste, hätte er
gesagt, dass der Typ auf jemanden wartete. Seine Neugier war geweckt und prompt vergaß er für den Moment, was er eigentlich noch vorhatte. Er versuchte, etwas vom Gesicht des Fremden zu erkennen,
der so merkwürdig an diesem verlassenen Platz umherwandelte, konnte aber nur etwas von schräg hinten erkenne. Angespannt observierte Henry die Person der sonstigen Welt völlig entschwunden. Dann
geschah etwas noch Seltsameres. Das Auto fuhr weiter und ließ die Person auf dem Feld zurück. Warum setzte man jemanden im Nirgendwo aus? Die anfängliche Neugier wich einem mulmigen Gefühl. Das
ganze Szenario war ihm nicht geheuer. Doch er wollte auch nicht ablassen. Er wollte wissen, was dort vor sich ging. Noch immer stand der geheimnisvolle Mann regungslos dar. Nichts von dem, was
Henry gerade beobachtete, ergab für ihn Sinn.
„Was hast du vor?“, fragte er sich.
Für einen Moment nahm er sein Fernglas zur Seite, um sich die bereits etwas müden Augen zu reiben, da nahm er den geheimnisvollen Schein wahr, der
am Himmel erschien. Es war kein Stern. Dafür war er zu niedrig. Für ein Flugzeug war er zu hell. War es ein Meteor, der dabei war, auf die Erdoberfläche einzuschlagen? Durfte er Zeuge eines
solchen Naturereignisses werden? Anderseits bewegte sich das Licht dafür viel zu langsam. Doch es bewegte sich – und das gerade auf den Boden zu. Als das mysteriöse Objekt etwa auf der Höhe war,
auf der Helikopter flogen, war zu erkennen, dass es rund war und von allen Seiten azurblaue-silberne Strahlen von sich aussendete. Nervös ergriff Henry erneut sein Fernglas und versuchte, das
Ding genauer zu identifizieren. Definitiv: Es war rund. Und es war…er konnte nicht sagen, was es war, doch das Objekt setzte seinen Weg stringent fort. Und wie reagierte der Mann? Henry schwenkte
auf ihn um und war überrascht, zu sehen, dass der Kerl noch immer genauso still dastand. Die unheimliche Erscheinung, die direkt auf ihn zukam, schien ihm nichts auszumachen.
„Was macht er da?“, zischte Henry vor sich hin.
„Warum bleibt er stehen und was geht hier vor sich?“
Die Logik gebot es, das, was seine Augen wahrnahmen, als Anlass zu nehmen, zu verschwinden. Und ja, Henry selbst verspürte Angst. Doch eine
irrationale Stimme, die ungleich stärker war, hielt ihn zum Bleiben an. Schamlos appellierte sie an dem Verlangen, das Unbekannte zu erkunden.
Das leuchtende Objekt erreichte schließlich den Boden. Durch sein Nachtsichtgerät konnte Henry es nun genau mustern. Es handelte sich dabei in der
Tat um eine perfekte Kugel, die offenkundig aus einer Art von Metall bestand, sicher konnte er es nicht sagen. Die Lichter erloschen. Der Mann gebar sich wie gehabt. Entweder hatte das Entsetzen
ihn so gelähmt, dass er nicht anders konnte oder er war unsagbar dumm. Oder gab es noch einen anderen Grund? Eine Tür öffnete sich an der Kugel und fuhr sich wie die Rettungsrampe an einem
Flugzeug aus. Henry spürte, wie sich jedes einzelne Haar an seinem Körper aufstellte.
Der Mann setzte sich zum ersten Mal seit seiner Ankunft auf dem Feld in Bewegung. Er ging etwas auf die Rampe zu. Gleichzeitig bewegte sich etwas heraus. Ein unbeschreibliches Grauen ergriff Henry. Eine Gestalt schritt die Rampe herunter. Sie war großgewachsen, in der Form glich sie in etwa einem Menschen. Doch der Hals war bestimmt fünfmal so lang und die Hände waren versetzt mit Krallen, die Dolchen glichen. Das gesamte Erscheinungsbild hatte etwas Reptilienartiges, ohne dass man es hätte in exakte Worten fassen können. Das Wesen – was immer es war – nährte sich dem Mann und umschmeichelte seinen Kopf mit seinen Krallen. Dabei blitze für einen Augenblick an dessen Hals etwas auf. Dieses Detail hatte Henry zuvor nicht bemerkt. Aber es war eine Art Halsband, das am Mann befestigt war und das dieses kurze Lichtsignal von sich gab. Die Kreatur gab ein Handzeichen in Richtung der Tür und nickte kurz darauf. Dann kehrte sie zurück in die Kugel und führte einen Ruck mit der Hand aus, sowie man die Leine eines Hundes zog. Der Mann ging auf Kommando hinterher, folgsam und ohne Widersinnigkeit – als hätte er keinerlei Kontrolle über seinen Körper mehr.
Als er sich etwa auf halber Höhe der Rampe bestand, wandte er sich in Richtung seines Beobachters, blickte ihn direkt in die Augen. Als würde er ihn bewusst anstarren und genau wissen, dass er
vom Berg herab beobachtet wurde. Aber woher? Furchterregender als dies, war jedoch der Umstand, dass…nein, das konnte nicht sein. Henrys Schrecken intensivierte sich. Er legte das Fernglas kurz
ab, rieb sich die Augen und setzte erneut an. Und doch, bot sich ihm der gleiche Anblick. Es war sein Bruder. Sein Gesicht war unverkennbar. Wie war das möglich? War es ein Streich, die die
Übermüdung ihm spielte oder der die nagenden Gewissensbisse, die ihm diese Fantasmagorie auftischten?
Mit anklagenden, verengten Augen sah Jonas seinen Mörder an,
als würde er Worte der Verteufelung an ihn richten. Henry wandte sich in schrecklichsten Erwartungen um. Zu seinem Erstaunen lag die Leiche noch immer an derselben Stelle. Er hievte sich auf und
ging zum Toten herüber. Die gleiche Position, in der er den Leib zurückgelassen hatte. Am liebsten wäre Henry sofort losgerannt. Sofort zum Auto und weggefahren, einfach darauf losgebraust. Doch
der Weg zu seinem Wagen würde zu nahe an den Schauplatz dieses Horrors führen.
Er wandte sich wieder dem Acker zu, auf dem das unerklärliche Ereignis stattfand und musste feststellen, dass sein Bruder bzw. das Irgendwas, das
seine Form angenommen hatte, fort und die Tür der fliegenden Kugel geschlossen war. Aber sie hob nicht ab. Nichts rührte sich für eine Zeit lang. Selbst der Wind war nun verstummt. Tiefe Stille.
Henry traute sich nicht, auch nur die kleinste Bewegung zu machen.
Auf der Straße näherte sich wieder Licht. Es war ein Auto, aber nicht nur irgendeines. Es war der Wagen, der unlängst zuvor Jonas Ebenbild
herausgelassen hatte. Doch dieses Mal hielt er nicht an der gleichen Stelle, sondern fuhr weiter. Henrys Augen folgten dem Schein. Zwischen den Bäumen hindurch war er noch vage zu erkennen. Er
blieb stehen. Henrys Atem stockte. Es war eindeutig, dass sie den kleinen Waldweg angesteuert hatten, der zu der Lichtung führte. Sie wussten, dass er hier oben lauerte und sie beobachte. Völlig
aufgelöst und ohne Kontrolle über seinen Körper setzte er zum Spurt an. Irgendwo hin, einen Ausweg, egal welchen. Ganz gleich, wer das war, der in dem Auto saß, kennenlernen wollte er ihn nicht.
Und noch weniger wollte er Bekanntschaft mit den Reptilienwesen machen. In seiner Aufregung hatte Henry allerdings nicht bemerkt, dass er dem Abgrund etwas zu nah kam. Als er loseilen wollte,
verlor er auf dem glatten Boden den Halt. Seine Füße gaben nach und schließlich kam sein ganzer Körper zum Fall. Unglücklicherweise stürzte er dabei nach hinten und rutschte über die Kante Fels
und Geröll hinab, erst noch eine Schräge, dann jedoch in die Senkrechte fliegend.
Henry erwachte inmitten von Matsch, Dornen und kaltem Schnee. Sein Körper war unterkühlt. Verwirrt und orientierungslos versuchte er, sich
aufzurappeln. Doch allein die leiseste Bewegung, sei es Arm oder Bein, rief in ihm solche Schmerzen hervor, dass er sich die Lippen Blutbeißen musste, um einen Schrei zu unterdrücken. Wie nach
der Marter des Räderns war er mit zertrümmerten Gliedern zur Bewegungslosigkeit verdammt. Einzig sein Puls raste im impulsiven Sprint. Röchelnd lag er da in seiner Hilflosigkeit und im
Bewusstsein, dass der eisige Atem der Nacht ihm ein Ende setzen würde.
Ein Knacken ertönte, gefolgt von einem Stapfen. Es klang nach schweren Schritten, die direkt auf ihn zuhielten. Sich dem Fiebertraum nahe wähnend
wandte der Verletzte seinen Kopf behäbig zu der Richtung, aus der die Geräusche kamen. Ein Schatten trat aus dem Dickicht hervor, gefolgt von den Umrissen einer schemenhaften Erscheinung. Sie
trat ins Mondlicht, das bleich durch die Kronen der Nadelbäume fiel und offenbarte sich. Für einen Moment hatte Henry befürchtet, dass es eines der Reptil-Wesen wäre. Doch es war offenkundig ein
Mensch.
„Hier ist er“, sprach eine grimmige, dunkle Stimme. „Komm her.“
Der Mann, dessen Gesicht zwischen Wintermütze und Schal verborgen war, trat an den unglückseligen Gestürzten heran. Eine weitere Person folgte ihm.
Er murmelte in einem Apparat an seinem Handgelenk.
„Es hat geklappt. Eure Koordinatenangabe war exakt. Wir haben ihn gefunden. Er lebt aber noch. Aber so wie es aussieht nicht mehr
lange.“ Er beugte sich musternd zu Henry herab, der flehte: „Bitte, helft mir.“ Doch beide ignorierten ihn.
„Ja, sehr schwere Kopfverletzung, er wird es wohl nicht lange machen. Wir melden uns dann wieder, wenn es so weit ist.“
Einer der Männer seufzte.
„Es ist ein Kreuz, dass wir in solchen Fällen nicht nachhelfen dürfen.“
„Es ist gegen die Vorschriften und die Ordnung“,
mahnte der andere unbekümmert. „Aber das dürfte schnell gehen. Ob Kälte oder der physische Schaden. Er ist bald tot, so wie der andere.“
„Was wollt ihr von mir?“, fragte Henry mit zittriger Stimme, doch noch immer wurde er missachtet. Schließlich gab er auf und ließ sein
Schicksal über sich ergehen. Innerlich verfluchte er seine Peiniger. Er verfluchte seinen Bruder, seine Frau und er verfluchte sich selbst, wünschte die ganze Welt zur Hölle. Dann mit einem
Schlag hörten die Schmerzen auf wie durch eine kurze Dosis des stärksten Schmerzmittels aller Zeiten. Nicht nur das, Henry fühlte, wie er seine Glieder wieder bewegen konnte. Seine Hände, seine
Füße, alles funktionierte einwandfrei und das Feuer in seiner Brust war erloschen. Seltsamerweise war von der beißenden Winterluft ebenso wenig zu spüren. Er begann erst gar nicht, in seiner
Euphorie diesen unglaublichen Umstand zu hinterfragen. Er stand auf.
„Sie an, es ist so weit“, merkte einer der Männer an. In seiner Erleichterung über die Linderung, die ihm widerfuhr, hatte Henry die
beiden schon fast vergessen. Als er ihre Stimme vernahm, wurde ihm augenblicklich in Erinnerung gerufen, dass sie offenkundig Übles mit ihm vorhatten. Also rannte er los. Vielleicht fünf Meter
kam er, als er spürte, wie sich etwas um seinen Hals schloss und eine Macht ihn am Weiterlaufen hinderte. Fassungslos musste er feststellen, dass sich ein Halsband an ihm befand – ein ähnliches,
das der Doppelgänger seines Bruders trug.
„Es hat keinen Zweck. Deine Seele gehört nun uns. Und sie ist verpflichtet, uns zu folgen.“
„Meine Seele?“ Diese Worte waren ihm so befremdlich und sinnentleert.
„Was macht ihr mit mir?“
Eine lautlose Stimme gab dem Mann mit dem Halsband den Befehl sich umzudrehen und so tat er es. Dabei fiel sein Blick auf den Leib, der am Boden gefroren war und ihm war klar, was seine Peiniger
damit meinten, wenn sie von Seele sprachen. Auch wenn er sich noch so sehr weigerte, anzuerkennen, was sich gerade abspielte, dass er es selbst war, der tot vom Schnee bedeckt war, konnte er
nicht leugnen. Jegliche Worte waren ihm versagt, um nur annähernd auszudrücken, was in ihm vorging.
„Gehen wir“, sagte einer der Männer und nahmen ihren Gefangenen an der unsichtbaren Bande mit. Widerstand war zwecklos. Sie zogen ihn durch den verschlungenen Trampelpfad hindurch auf den
ausge-wiesenen Waldweg bis zu der Einfahrt, an der die beiden Wagen standen. Sie zwangen ihn in ihr Auto und fuhren los – es erübrigte sich jede Frage, wohin. Dementsprechend war die Fahrt nur
von kurzer Dauer. „Geh nun los zum Schiff“, befahl einer der Männer und gegen jeden Willen tat Henry, wie ihm geheißen wurde.
Letztendlich war er es nun, der vor der mysteriösen Kugel, diesem überirdischen Fluggerät stand und voller demütiger Panik betrachtete, wie sich die
Tür abermals öffnete. Eine der Echsen Kreaturen trat heraus.
Vom Nahem wirkte sie noch einschüchternder. Sie ging anmutig auf den Menschen zu, der im Vergleich wie ein Zwerg wirkte und tastete ihn behutsam ab.
„Ja, diese Seele hat Energie“, schnarrte die Kreatur. „Irgendwie scheinen Verbrecher doch mehr Energie zu haben. So gehe nun hinein ins Schiff. Deine Seele wird einen hohen Dienst verrichten, zur Rettung unserer Welt. Sie ist wertvolle Energie.“
Die Monstrosität ging voran und Henry folgte wortlos in das Schiff, dem grellen Schein entgegen. Zu klaren Gedanken war er längst nicht mehr fähig.
Die Tür schloss sich. Das Fluggerät hob ebenso leuchtend ab, wie es herabkam. Als es sich am Zenit des Himmelszeltes befand, durchzuckte ein kurzer Blitz das tiefe Schwarz, kaum mehr als der
Bruchteil einer Sekunde, und es war verschwunden. Die beiden Männer, die ihre neue Fuhre abgeliefert hatten, hatten den Ort des Geschehens indessen schon längst hinter sich
gelassen.
„Ok, einen Auftrag haben wir für heute Abend noch“, sagte der Eine.
„Sektor G67, Abschnitt B. In zwei Stunden wird dort
jemand sterben, sagt die Zentrale. Die Zeitkamera hat hier eine Aufnahme übermittelt. Ein Typ begeht Selbstmord. Schneidet sich die Pulsadern auf.
„Dann machen wir uns mal auf den Weg“, grummelte der andere.
„Du hörst dich ziemlich genervt an.“
„Will man es mir verübeln? So langsam habe ich es satt, den Menschen beim Sterben zuzusehen auf die aller dümmsten Weisen. Das Seelensammeln verliert seinen Reiz.“
„Ich muss dir zustimmen. Aber was will man machen. Unser Überleben hängt von der Energie ab und irgendwer muss die Drecksarbeit ja machen.“
„Da hast du wohl recht. Aber der Sammlerdienst ist so dumpf nur noch. Vielleicht lasse ich mich doch in die Beobachtungsmannschaft versetzen. Hätte selbst mal Lust, andere durch die Gegend zu schicken. Und ich will nicht mehr in dieser abscheulichen Körperform herumlaufen. Ich denke, ich werde gleich morgen meinen Antrag auf Versetzung stellen.“
ENDE
Heiße Weihnacht
(Urheberrechte & Copyrights © by Michael Kothe)
»Gentlemen, ich bitte um Ihr Verständnis, wenn ich mich aus der Verhandlung zurückziehen muss. Gerade habe ich erfahren, dass sich bei mir zu Hause ein Unglück ereignet hat. Herr Dr. Schwarz, mein Stellvertreter, wird Ihnen die noch offenen Details erläutern und anschließend den Vertrag zur Gegenzeichnung aushändigen.«
Während er sprach, hatte Dr. Markgraf seinen Sessel von dem Konferenztisch fort geschoben und stand nun vornübergebeugt vor der aufgeschlagenen Mappe, die die Vertragsausfertigungen enthielt. Zwischen den eilig hingeworfenen Unterschriften hob er den Kopf und nahm Blickkontakt zu seinen Verhandlungspartnern auf. Deren leichtes Kopfnicken signalisierte ihm ihr Mitgefühl und die Zustimmung für seinen Aufbruch.
Dr. Schwarz schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln, als er den Füllfederhalter in der Innentasche seines Jacketts versenkte und sich mit einem knappen Bückling in Richtung der Geschäftspartner verabschiedete, wobei er die flach aneinander liegenden Hände vor seine Brust hielt. Er eilte zu seiner Sekretärin, die in die Verhandlung geplatzt war und, während sie sich über ihn beugte, ihm die schlimme Nachricht zugeraunt hatte. Jetzt stand sie im Eingangsbereich des Konferenzzimmers und hielt ihm die Tür auf.
»Was ist eigentlich passiert? Wie schlimm ist es?«
Sie zuckte die Schultern.
»Leider kann ich Ihnen nichts sagen. Als ich aus dem Archiv ins Büro zurückkam, blinkte der Anrufbeantworter. Ihre Frau hatte in den Minuten, die ich fort war, darum gebeten, Sie mögen schnellstmöglich nach Hause kommen, es habe ein schreckliches Unglück gegeben.«
»Haben Sie versucht, meine Frau zu erreichen?«
»Natürlich, aber es hat niemand abgenommen.«
Markgrafs Gedanken rasten. Seine Frau nicht erreichbar, ihr gemeinsamer Sohn Stephan war mit drei Jahren noch zu klein für ein Smartphone, und seine Stieftochter Melanie hatte in ihrer Verträumtheit ihres sicherlich irgendwo herumliegen. Hastig hängte er das Sakko über die Lehne seines Bürosessels und schlüpfte in die dick gefütterte Lederjacke, tastete, ob sich Haus- und Autoschlüssel wirklich in der Jackentasche befanden, und war nach einem flüchtigen Gruß zu seiner Sekretärin schon aus dem Büro hinaus. Die Wartezeit vor dem Fahrstuhl und die Fahrt in die Tiefgarage wurden zur Qual. Was ist geschehen? Eine erpresserische Entführung meiner Kinder? Lohnen würde sich das für die Kidnapper schon. Ein Unfall im Haus oder auf eisglatter Straße? Hätte ich meiner Sekretärin bloß gesagt, sie solle die Krankenhäuser abklappern!
Hinter dem Steuer wurde er ruhiger, der Straßenverkehr erforderte seine Aufmerksamkeit.
***
Unterwegs bemühte er sich immer wieder, durch Spekulationen Licht in das Dunkel der Geschehnisse zu bringen. Von innerer Unrast getrieben versuchte er, den vorigen Abend vor seinem geistigen Auge ablaufen zu lassen, nachdem er sich an nichts Konkretes vom heutigen Tag erinnern konnte, das er mit einem Unglück in Verbindung gebracht hätte. Heute war der 25. Dezember, aber der Vertragsabschluss war für ihn und seine Firma wichtig genug, um am Vormittag seine Familie allein zu lassen. Nicht alle Asiaten feierten nun mal Weihnachten.
Die Bescherung gestern war geprägt von Unruhe, die Minuten danach ließen auch nichts an Dramatik zu wünschen übrig. Die Elfjährige, Melanie, drängte, dass die Eltern sie zum Weih-nachtsgeschenk führten, was Markgraf gern tat, obwohl er im Geiste schon bei der Vertragsverhandlung war. Kurz schüttelte er den Kopf, um diese Gedanken zu vertreiben. Wieder entspannt lächelte er seine Stieftochter an in der Hoffnung, dass seine Hinwendung zu ihr und ein freundlicher Gesichtsausdruck hier und da zu einem innigeren Verhältnis führten! So legte er ihr das Geschenk in die Arme und wartete, bis sie das teure Geschenkpapier abgerissen und den aufwändig gestalteten Karton lieblos aufgebrochen hatte. Hilflos hatte er zu seiner Frau geblickt, die mit vor Schreck geweiteten Augen ihre Tochter anstarrte. Melanies Körper war steif, ihre Augen aufgerissen, und mit zusammengebissenen Zähnen hatte sie das Pony aus seiner Formverpackung gezerrt. Mit beiden Händen umfasste sie die Spielzeugfigur um die Körpermitte, die Finger-spitzen konnten sich gerade berühren, und hielt es mit ausge-streckten Armen so weit wie möglich von sich. Das fernsteuerbare Geländefahrzeug mit Pferdeanhänger, Jockey und Sulky – alles im Maßstab zum Pferd passend – würdigte sie nur eines kurzen Blickes.
»Das habe ich nicht gewollt! Das tausche ich um! Susanne hat einen Tablet-PC bekommen und kann damit nichts anfangen, aber auf solchen Kinderkram wie das hier steht sie. Und wenn nicht mit ihr, dann tausche ich mit Mara. Sie weiß nicht, was sie mit ihrem neuen Chemiebaukasten anstellen soll. Das doofe Pferd behalte ich jedenfalls nicht.«
Bevor die Tränen aus ihr herausbrachen, hatte sich Melanie schon umgedreht und war den Flur entlang in ihr Kinderzimmer gerannt. Ihre Eltern hörten die Türe knallen, und ein »Wumm, wumm« signalisierte, dass das Mädchen seine Wut und Enttäuschung an Wand und Möbeln ausließ. Nur mit Mühe hielt Frau Markgraf ihren Mann davon ab, Melanie nachzueilen.
»Glaub mir, es ist besser, wenn sie sich erst einmal abreagiert. Ich kenne sie besser als du.«
Den Wutanfall verstand Markgraf partout nicht, denn ein Pony hatte sie sich doch gewünscht! Wochenlang hatte sie ihren Eltern damit in den Ohren gelegen, gelegentlich schon, seit sie nach den Herbstferien aus dem Ferienlager zurückgekommen war. Was war dann der Grund für die Enttäuschung? Nun zog ihn die Erinnerung daran wieder in die Realität zurück. Plötzlich quälte ihn eine noch schlimmere Befürchtung: Hatte seine Tochter sich etwas angetan?
Den Rest der Strecke musste er sich zusammenreißen, um seine Konzentration auf die winterlichen Straßenverhältnisse zu richten. Immer wieder zuckte er zusammen, wenn ihm seine Einbildung Bilder vorgaukelte, in denen Melanie sich in chaotischen bis skurrilen Szenen lebensbedrohlichen Gefahren aussetzte. Nass geschwitzt erreichte er endlich sein Wohnviertel.
***
Als er in die Straße einbog, in der sein teurer Bungalow zwischen den übrigen Luxushäusern kaum auffiel, waberte ihm schon das stroboskopartige Blaulicht mehrerer Einsatzwagen entgegen. In den Vorgärten der Nachbarschaft führten Lichtergirlanden und Weihnachtsbäume einen aussichtslosen Kampf gegen das blaue Leuchten. Bis zu seiner Auffahrt kam Markgraf gar nicht durch, ein Polizeifahrzeug hatte gut einhundert Meter vorher die Fahrbahn blockiert.
Er brachte sein Cabriolet knapp daneben zum Stehen, beim Aussteigen zitterten seine Knie. Im letzten Moment wich er dem Krankenwagen aus, der ihm mit blauem Blinklicht auf dem Bürgersteig entgegenkam. In seiner Anspannung hatte er ihn vorher übersehen. Seine Frau? Stephan? Oder doch Melanie? Er rannte. Auf halber Strecke sah er seine Frau am Straßenrand vor der Einfahrt stehen, einen Arm schützend um den Dreijährigen gelegt. Er merkte, wie sie immer wieder zusammenzuckte. Also doch, Melanie, ihre Tochter aus erster Ehe!
»Halt! Hier dürfen Sie nicht weiter.«
Verständnislos gaffte Markgraf den Uniformierten an, der sich urplötzlich vor ihm aufgebaut hatte und ihm nun beide Hände vor die Brust drückte, damit er stehen bliebe.
»Was ist …? Ich bin …, das ist mein Haus!«
Verwundert starrte er auf seinen Arm, den er unwillkürlich ausgestreckt hatte und der auf sein Heim zeigte – oder auf das, was davon übrig war. Erst jetzt nahm er wahr, dass vor seinem Grundstück und auch auf dem Rasen Löschfahrzeuge standen. Einsatzkräfte in dicken hellbraunen Feuerschutzanzügen, ausge-stattet mit neongelben Helmen und mit Atemschutzgeräten, machten sich nur scheinbar behäbig auf den Weg in seinen Bungalow, der aus Tankfahrzeugen mit dicken Wasserstrahlen beschossen wurde. Nur Qualm stieg aus der Ruine, Flammen konnte er nicht sehen. Ihm wurden die Knie weich, noch rechtzeitig stützte er sich an einem der brusthohen Edelstahlkästen ab, in denen seine Nachbarn ihre Mülleimer verbargen.
»Herr Dr. Markgraf, hat man Sie doch erreicht! Ihre Frau war sich nicht sicher, ob die Nachricht an Sie weitergegeben wurde.«
Markgraf blickte auf. Den Einsatzleiter der Feuerwehr kannte er. Von welchem Clubtreffen, fiel ihm nicht ein.
»Was ist …« Er schluckte. »Was ist geschehen? Meine Frau sehe ich, unseren Sohn auch. Aber was ist mit Melanie? Sie ist doch nicht …«
Der Einsatzleiter winkte einen Mann in Zivil herbei.
»Schweigert ist mein Name, ich bin Notfallseelsorger.«
Markgraf rutschte an dem Müllhäuschen hinunter, bis er im Schneematsch auf dem Bürgersteig zu sitzen kam. Die Nässe zog sofort in seine Kleidung, er spürte es überhaupt nicht.
Schweigert fuhr fort. »Wie ich von der Feuerwehr erfahren habe, ist der Brand in einem der rückwärtigen Räume …«
»Die Kinderzimmer!«, schrie Markgraf auf.
»…, ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind mit Atemgeräten auf dem Weg dorthin. Wenn Sie …«
Markgraf raffte sich auf und schob den Seelsorger mit einer unwirschen Armbewegung zur Seite. Wie ein Traumwandler stakte er auf seine Frau zu, nichts von seiner Umgebung nahm er wahr. Seine Tochter! Als Vater sollte sie ihn akzeptieren. Lieben. Zu viert sollten sie eine Familie sein. Und nun … im Kinderzimmer! Verbrannt, verschüttet, erstickt? Unter Tränen erkannte er das Gesicht seiner Frau, bei der er gerade angekommen war. Fahrig und ohne es selbst wahrzunehmen, strich er Stephan übers Haar, unbewusst versuchte er, Trost zu spenden.
»Melanie?« Es fühlte sich an, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen.
»In ihrem Zimmer ist wohl der Brand ausgebrochen. Das sind die vorläufigen Vermutungen der Feuerwehr. Weil hier vorn noch nicht so viel verbrannt war, als sie kamen.«
Er schlug sich an die Stirn. Hatte sie sich wirklich etwas angetan? Oder war sie wieder einmal nur unvorsichtig gewesen? Schon öfter konnte Schaden gerade noch abgewendet werden, den ihre Fahrigkeit und Unkonzentriertheit heraufbeschworen hatten. Ein Föhn, ein elektrischer Heizofen? An der Gardine, der Bettdecke? Mit beiden Händen griff er seine Frau an den Schultern und schüttelte sie.
»Und Melanie?«
Seine Frau lächelte.
»Sie war als erste aus dem Haus. Hat Stephan und mich an der Hand gepackt und nach draußen gezerrt. Das war gleich, nachdem ihre Freundinnen wieder verschwunden waren. Sie hatte mit ihnen telefoniert, und beide waren gekommen. Susanne hat mir schulterzuckend ihr Tablet gezeigt, und Mara hatte einen Karton in einer großen Einkaufstasche angeschleppt. Sie blieben nur ein paar Minuten. Aber es war recht laut zugegangen im Kinderzimmer, die drei haben sich gestritten. Offenbar wollten die beiden ihre Sachen doch nicht gegen das Pony eintauschen.« Aufgeregt blickte sie sich nach allen Seiten um, nun zitterte auch ihre Stimme. »Aber du hast recht. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen.«
Melanie lebte!
Markgraf ließ seine Frau stehen. Zwischen den Einsatzfahrzeugen rannte er hin und her. Irgendwo musste Melanie jedoch stecken! Und dann sah er den hellgrauen Strickpulli, auf dem der Hinterkopf von Mickeymaus prangte. Oder von Minnie? Egal! Er hatte seine Tochter entdeckt. Als Erste draußen? In ihrem Zimmer der Brand ausgebrochen? Oh, Kind, wobei bist du jetzt wieder unvorsichtig gewesen? Antworten auf diese Fragen waren im Moment jedoch gleichgültig. Er schlängelte sich zwischen Fahrzeugen, Schlauch-rollen und Menschen hindurch, die ihn aufhalten wollten, und strebte seiner Tochter zu. Gleich würde sie sich umdrehen, ihn erkennen und auf ihn zulaufen. Ihre Arme würde sie um seine Hüfte schlingen, ihren Kopf würde sie an seine Brust drücken und schluchzen.
»Papa, das hab´ ich nicht gewollt«, würde sie ein ums andere Mal rufen. Er würde in die Hocke gehen, mit ihr auf Augenhöhe ihre Tränen trocknen, ihr liebe Worte zuraunen und sie trösten. Sie wäre endlich seine Tochter, und er wäre von nun an als ihr Vater akzeptiert! Er blieb stehen, den Moment der Vorfreude wollte er auskosten. Ein Haus konnte man wieder bauen, die Einrichtung wieder kaufen. Die Liebe seiner Tochter jedoch war unbezahlbar.
Da drehte sie sich um. Minnie Maus lachte ihn von ihrem Pullover her an. Melanie kam langsam auf ihn zu, er ging in die Hocke und strahlte.
Wenige Schritte vor ihm blieb seine Tochter stehen, die Füße schulterbreit auseinander, und stemmte ihre Fäuste in die Seiten. Ihre Augen funkelten zornig, und trotzig reckte sie ihm ihr Kinn entgegen. Ihr Mund wurde breiter, die Lippen öffneten sich und zogen sich zu schmalen Strichen. Zwischen den Zähnen presste sie hervor:
»Wetten, im nächsten Jahr kriege ich zu Weihnachten ein richtiges Pony!«
ENDE
Die Weihnachtsüberraschung findet ihr in Michael Kothes Sammlung »Quer Beet aufs Treppchen 2020–21«. Mehr Info zum Buch auf https://autor-michael-kothe.jimdofree.com. Über eure Amazon-Sterne würde sich der Autor freuen.
Doerte Krebs

Doertes kurzer Steckbrief:
Jahrgang 1961, lebt in Hamburg, hat zwei erwachsene Töchter und verdient ihren Unterhalt als Objektplanerin in der Baubranche. Eine unbescholtene Texterin und Bogenschützin weiß, wovon sie schreibt und freut sich über Leserinnen und Leser. Komplimente und Kritik sind gerne erwünscht.
Doerte Krebs, mit Ihrem herausragenden Beitrag zum Wettbewerbsthema des zweiten Semesters 2021.
In Varde
(Urheberrechte & Copyrights © by Doerte Krebs)
Heute wurde im Parlament der Weg freigemacht für das Programm Viva – Menschen der Welt. Das Gesetz regelt die Auswahl und die Rechte von Menschen in Europa, die in dem weltweit angelegten Rettungsprogramm die Unsterblichkeit erlangen sollen. Die Auswahl ist Ehrensache und soll vergleichbar der Berufung von Schöffen erfolgen. Ein Vetorecht gibt es nicht. Man geht davon aus, dass nur wenige Menschen für das Programm infrage kommen. Faktisch kann Europa lediglich tausendfünfhundert Personen benennen. Ziel dieses Programms ist die Sicherung der menschlichen Spezies über die Zeit der Flut hinaus. Das Prozedere für Nutztiere ist bereits vor Jahren verabschiedet und erfolgreich umgesetzt worden. Die Wissenschaft hat daraus wichtige Erkenntnisse gewonnen, die ihr bei der Umsetzung des aktuellen Programms helfen werden. Es handelt sich um eine prophylaktische Maßnahme, die die Eignung des Menschen für den langfristigen Aufenthalt in einem außerirdischen Schutzraum prüfen soll. So könnte bei weiterem Verlust von irdischem Territorium, bei einer Entspannung der Situation eine Rückbesiedelung der Erde durch den Menschen erfolgen.
Das waren die Nachrichten zum Mittag.
Gunnar sinkt zurück in seinen Sessel. Wollte er doch niemals wieder damit zu tun haben, aber er erinnert sich noch ganz genau an die letzte Gesellschafterversammlung seiner damaligen biopharma-zeutischen Firma VIVA. Um fünf Uhr morgens stieß er die Flügeltür des Konferenz-saals gegen den gerade heranrollenden Servierwagen. Er entschuldigte sich nicht. Er flüchtete aus dem Hotel in Lissabon und vor seinen Partnern. Es war noch dunkel; er fror und er wusste, das würde so bleiben.
VIVA, kein anderes Produkt ihrer hochwirksamen Pflanzenheilmittel, hatte eine solche Dynamik entwickelt. Duft und Spur hatten sie Doreen zu verdanken gehabt. Sie, die immer auf der Suche nach voreiszeitlichen Pflanzen gewesen war, süchtig das Rätsel ihrer Überlebenskunst zu lösen, hatte die Pflanze am Fuß des Mount Hagen auf Papua-Neuguinea gefunden. Gunnar hatte die Kommunikation entschlüsselt, Kitai diese in ihre chemischen Bestandteile zerlegt und Abril hatte die Wirkstoffe zusammengebracht, mit Träger- und Botenstoffen. Gemeinsam war ihnen ein fein bemessenes, maskiertes und gerührtes Wunder gelungen. Von außen aufgetragen – die Erkenntnis dieser Bedeutung war der Durchbruch gewesen – ausgestattet mit einer Eintrittskarte in das Nervensystem befähigte es Zellen, sich immer wieder zu teilen und neu zu bilden, mit dem Wuchs eines Keimlings oder auf den Menschen übertragen mit dem Vermögen eines Pubertierenden. Der Alterungsprozess des Körpers wurde ausgesetzt.
Nach erfolgreichen Versuchen mit Schweinen hatten sie das Mittel an sich selbst angewendet. Dieses No-Go unter Wissenschaftlern war ihnen später, nachdem die damals noch unabhängige Presse von VIVA berichtet hatte und der Hyphe um die Entzauberung des ewigen Lebens den um die Mondlandung in den Schatten gestellt hatte, verziehen worden.
Zu dem Zeitpunkt war Gunnar aber bereits aus dem kometenhaften Megatrip herausgefallen, in dem sie seit zwei Jahren umeinander rotierend auf den Selbstversuch zu gerauscht waren. Mit den Vorbereitungen zu einer ersten Veröffentlichung hatte Gunnar auf einen Schlag eine unbeteiligte Sichtweise eingenommen und war an einen Abgrund geraten. Mit Kitai, seinem Partner aus Japan teilte er eine wachsende Verzweiflung. Sie hatten kein Heilmittel geschaffen, sondern überflüssigen, ja schadhaften und begehrlichen Luxus.
Das gigantische marktwirtschaftliche Potenzial konnte bei VIVA nicht übersehen werden. Einen Gedanken, an dem insbesondere Doreen Gefallen gefunden und sich innerhalb eines halben Jahres von einer Seherin für Pflanzenpotenzialen zu einer Marketingstrategin geboostert hatte.
Kalkül für Einsatz und Nutzen war Doreen schon immer wichtig gewesen. Mit ihrem hartnäckigen Bestehen auf nur wenige, intuitiv bestimmte Exkursionsziele, statt einer systematischen Suche, wie es wissenschaftlich geboten gewesen wäre, hatten die Anderen sich angewöhnt, ihren erfolgreichen Methoden zu folgen.
Die Pflanze Amalane, der sie VIVA zu verdanken hatten, gehörte zur Gattung der Schachtelhalme und war schon vor der letzten Eiszeit fester Bestandteil der Vegetation gewesen. Das waren Kitais und Gunnars ersten Argumentationsstränge gegen die Vermarktungs-Ideen von Doreen gewesen. Ihr wertvoller Wirkstoff war nicht für den Menschen, sondern zum Erhalt der Pflanze in einem wechselhaften Umfeld vorgesehen gewesen. Und wer wusste schon, ob die Fähigkeiten dieser oder auch anderer Pflanzen den Menschen nicht schon einmal bekannt gewesen und nur durch den zähen Kampf der Schulmedizin um Deutungshoheit in Vergessenheit geraten waren. War doch die Revolutionierung der Pflanzenheilkunde maßgeblich von den afrikanischen Kollegen ausgelöst worden. Mitte der dreißiger Jahre war dort ein Medikament gegen Covid entwickelt worden, das die Wirksamkeit der Schulmedizin in den Schatten gestellt hatte. Das Wissen seiner afrikanischen Kollegen, um die Anpassung und die Kommunikation von Pflanzen mit ihrer Umgebung war vielschichtig und in einer Spiritualität eingewoben gewesen, die der damals aus Europa aufgebrochenen und sich fast weltweit zementierten Wissenschaft völlig fremd gewesen war und sie blind gemacht hatte für irdische Kompetenz. Abril und Kitai waren im Ringen um die Verantwortung für die außerordentliche Wirkung von VIVA, an deren Diskussion sich Doreen nicht mehr beteiligt hatte, zu der festen Überzeugung gekommen, dass der Mensch kein Recht an Pflanzen, deren Inhaltsstoffen und Potenzialen haben kann, alle mal nicht durch ein Patent, um sie vor dem Gebrauch durch andere Menschen zu schützen.
Der andere Aspekt ihres Widerstandes betraf die Erfahrungen, die der Mensch bereits mit dem ewigen Leben und dem Fluch der Unsterblichkeit gemacht hatte. Ja, es war einer der großen Träume der Menschheit und in den monotheistischen Weltreligionen das Heilsversprechen schlechthin für den Preis des Sterbens, aber in der Realität eines ewigen Lebens im Diesseits als Qual und Fluch beschrieben worden, als ein Irrweg und zum Schaden der Menschheit. Über all dies diskutierten sie leidenschaftlich. Und genau der Schaden lag hier offensichtlich auf der Hand. Menschen, reiche Menschen, denn nur die würden sich das Mittel leisten können – würden keinen Platz machen für spätere Generationen. Widersinnig den Druck auf die Ressource Land zu erhöhen, wenn die Flut diesen Lebensraum kontinuierlich schmälerte. Was für vier Leute einen nie zu verbrauchenden Gewinn schaffen könnte, für dessen Realisierung Doreen um die Welt reiste, würde die Grundlage zerstören davon als Mensch Gebrauch machen zu können.
Oder sollte das Ziel gewesen sein, die Fortpflanzung einzustellen und hier und jetzt kraft der materiellen Stellung in der Gesellschaft die Entscheidung zu fällen, wer auf ewig weiter machen dürfte? Allerdings nur mit unfruchtbarem Sex.
Dann war die Katastrophe eingetreten, wie Doreen es nannte, mit dem Ausbruch des Mount Hagen im März 2045. Der Nordhang, an dem die nur dort anzutreffende Amalane wuchs, war mit einer drei Meter starken Lavaschicht überrollt und ausgebrannt worden. Doreen hatte umgehend eine Gesellschafterversammlung einberufen, noch gewitzelt, dass sie vier sicher noch leben würden, bis der erste unverdaute Same der Amalane von dem Aschevogel auf der Ostseite ausgeschissen und mit dem Staub über die Jahrzehnte und den Aufwinden über der sich langsam abkühlenden Lavaschicht an seinem optimalen Standort getragen und in einer Lava Falte wieder zu neuem Leben erwachen würde. Sie verfügten zu diesem Zeitpunkt einzig und alleine über die Ernte von 2044.
Er hört Marta in den Hausflur gehen. „Ich hole die Kinder ab“, ruft sie zu ihm hoch. Die Tür fällt ins Schloss. Er steht auf und winkt ihr durch das offene Fenster nach. Aber Marta schaut nicht zurück, sie schnuppert an den Rosen, blickt über die Gemüsebeete im gut geschützten Vorgarten und auf die alles überragende Zucchinipflanze und verlässt das Paradies. Varde ist kein guter Ort mehr und seine Bewohner nicht mehr Teil einer Gemeinschaft. Auch Gunnar hat Angst, im Zusammensein mit anderen könnten seine Zweifel sichtbar werden. Marta ist schon fast vorne an der Ecke, dann verschwindet sie aus Gunnars Blickfeld hinter dem Bürgercenter.
Gunnar setzt sich mit dem Rücken zum Garten in die Fensterbank.
Ihr Konflikt war durch die Endlichkeit des Wirkstoffs mit einem Turbo ausgestattet worden. Mag sein, dass Doreen schon vor dem Vulkanausbruch Kontakte mit Investoren aufgenommen hatte. Fakt blieb, dass sie sich durchzusetzen wusste. Zweifel sind wenig wirksam bei einem Streit. Die Strategie von Abril, Kitai und Gunnar war bis Dato nur der Verzicht, ein kraftloses Argument für die Last der Verantwortung gegen die Wucht des Geldes.
In der Mitte der nächtlichen Sitzung ließ Doreen ihr gemeinsames Ringen um wissenschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung platzen. Mit Ihrem Bekenntnis das Angebot eines Investors entgegen- genommen zu haben, eröffnete sie eine wilde Jagd und schaffte es, sie, die Gesellschafter, aus ihrer gemeinsamen Verantwortung in die vier Ecken des Raums zu isolieren. Es gelang Gunnar nicht mehr Kitai zu erreichen, um ihn mit ihren gemeinsamen Zweifeln zu konfrontieren und bei seinem Gemeinsinn zu packen. Ganz im Gegenteil, Doreen traf ihn genau dort, bei seiner sozial ausgerichteten Haltung. Er sollte seine Stilisierung als demütiger Erdretter aufgeben und den Mut der Investoren anerkennen, eine verantwortliche Verwendung für ihre Lebensleistung VIVA zu finden. Und Abril? Sie war damals bereits krank, ihr Krebs wuchs so munter, wie Doreen das Geld in der Kasse klingeln hörte und schneller als ihre verjüngten Zellen. Sie ließ sich von Doreen in den Sattel heben und ritt den zügellosen, goldenen Gaul immer weiter an Doreens vorderste Front. Sie brauchte Geld für Ihre Therapie. Doreen schraubte die Preiserwartungen in die Höhe, in dem sie die Bedingungen für den Verkauf der Firma weiter reduzierte bis auf eine einzige – die vier Gesellschafter sollten vor dem Geschäftsübergang eine weitere Behandlung mit dem Mittel erhalten. Alle Rechte an der Pflanze, der Wirkstoffentwicklung und an der Rezeptur des Mittels und seiner Verwendung sollten aufgeben werden.
Doreen hatte Speed genommen, anders konnte es nicht sein, dass jeder seiner Einwände tausendfach von ihr widerlegt wurde, sie würde noch drei Tage so weiter argumentieren können. Gunnar nicht. Gunnar erschöpfte das fehlende Gespräch, Differenz auszuhalten fand er unsachlich, obwohl er wusste, dass es hier um Macht ging. Er hörte auf zu argumentieren, folgte schweigend dem nun fast einvernehmlichen Gespräch und dem Entschluss seiner drei Mitinhaber. Über dem Berg von Caparica ging der Mond unter. Gunnar verzichtete auf eine weitere Behandlung, dieser Entscheidung schloss sich Kitai an. Damit stieg der Verkaufswert, der einzig noch von der Anzahl der Behandlungsgaben bestimmt war, noch einmal. Gunnar sprang auf, er spürte Doreens Triumph im Rücken, als er auf die Tür des Sitzungssaales zueilte. Scham, schnellte aus seinem Geschlecht in den Schädel und explodierte.
Nach den Formalitäten des Verkaufs und wieder zurück in ihren Heimatkontinenten teilten sie das Geld auf. Es betrug weniger, als Doreen in Aussicht gestellt hatte, aber zu viel für einen Menschen. Gunnar und wahrscheinlich auch die anderen versuchten sich ihr großes oder kleines Glück daraus zu bauen. Doreen wurde Geschäftsführerin bei VIVA, ging es also doch auch um Macht. Abril nahm sich ein Jahr nach Lissabon das Leben, sie hatte Zuflucht in einem Jesuiten-Kloster in Ihrem Geburtsort in Argentinien gefunden. Einzig mit Kitai blieb er in Kontakt. Über den Verkauf haben sie nie wieder gesprochen, aber sie haben sich noch Jahre lang ausgetauscht und festgestellt, dass beide an einer Müdigkeit zu leiden begannen, bei gleichzeitig agilem Körper. Gunnar blieb dabei, jeden Tag zwanzig Kilometer zu laufen, sein Herz und seine Lunge arbeiteten perfekt. Aber eine Art Abwehr, aus der Resignation wurde, teilten Gunnar und Kitai, als ob das Hirn zur Aufnahme und Verarbeitung nur eine begrenzte Kapazität hätte.
Gunnar verlässt seine Bibliothek und geht nach unten in die Küche. Er zapft sich ein Glas voll Wasser und setzt sich an den Tisch mit dem grandiosen Blick über die Dünenkante auf den kleinen Sund, der sich nach Westen zum Meer öffnet. Vor dreißig Jahren war es noch die Ansicht auf ein liebliches Tal gewesen, dessen Bach erst fünfzig Kilometer weiter westlich ins Meer geflossen war.
Das Programm Viva soll also die Arche Noah der Neuzeit werden. Gunnar stellt sich den zwanghaften Zustand in einer Raumkapsel vor, die Qual über den ungewissen Ausgang. Das muss damals, in der sagenhaften Geschichte, die Eingang in das Alte Testament gefunden hatte, nicht anders gewesen sein. Gunnar fehlt der Glaube. Wie sollen die außerirdischen Räume gesteuert werden, wenn die Zentralen auf der Erde von den Kräften der Natur zerstört wurden, vom Sturm, Wasser, Hitze oder Kälte? Der Mensch begreift sich nicht. Nach wie vor geht er davon aus, zu herrschen und die Erde nutzen zu können, wie es ihm gefällt. In der Krise würde es dem Menschen noch nicht einmal mehr gelingen seinesgleichen zu beherrschen.
Hier eine Vermisstenmeldung: Zwei Wissenschaftler auf dem Weg von Rotterdam nach Bremen sind nicht am Zielort angekommen. Sie wurden zuletzt von einer Kamera erfasst, als sie gestern in Oldenburg ein atomares Schiff Richtung Cuxhafeninsel betreten haben. Das Boot kann seitdem nicht geortet werden. Eine Entführung ist nicht auszuschließen. Die Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert jeden Hinweis zum Verbleib der Personen zu melden. Es handelt sich um eine ein Meter sechzig große, zierliche Frau, hellhäutig, mit dunkelbraunem, kurzem Haar und einen ein Meter achtzig großen, kräftigen Mann, hellhäutig und mit kurzem, blonden Haar.
Das waren die Nachrichten zum Nachmittag.
Gunnar bekommt ein Bild zu fassen, er ist hellhörig, aber der Lautsprecher verstummt. Suchmeldungen oder Aufrufe zur Denunziation gibt es fast nicht mehr. Dafür hört er jetzt seinen Namen. Aus der Ferne. Marta ruft ihn. Sie muss noch weit entfernt sein. Er steht auf. Die Suchmeldung verrät, dass die Ortung der vermissten Wissenschaftler außer Funktion ist. Menschen ohne Chip gibt es nur noch in unkontrollierten Gebieten, wie in den Bergen von Afghanistan oder eben in Afrika. Gunnar geht zur Tür und öffnet sie. Marta rennt über den Klitstien, sie biegt auf den Wohnweg ein, Gunnar setzt sich in Bewegung.
„Der Bus hat nicht gehalten!“ Marta packt Gunnar am Arm. Seit es die Wochenschulpflicht gibt, liegen Martas Nerven blank, was die Zwillinge betrifft. Zuerst waren die Internate nur eine Möglichkeit gewesen, und gerne genutzt von auswärtig beschäftigten, meist heimatlosen Produktionskräften, das reichte dem Staat nicht, war er doch dabei seinen Einfluss auszudehnen. Zuerst führte Asien die Internatspflicht ein, dann folgten Europa und Nordamerika.
„Bevor der Bus abbiegen musste, ist er aus dem Radar gefallen.“ Sie zeigt auf die Smartbrille.
„Aber ich habe ihn doch gesehen, wie er vorbeigefahren ist auf dem Vestervej. Er ist nicht abgebogen! Gunnar, was können wir tun?“
Er nimmt sie in den Arm, Marta ist die dritte Frau, mit der er eine Familie gegründet hat, und sie ist die stärkste. Aber länger als bis zum dritten Kind hat es keine mit ihm ausgehalten. Mach, dass sie bei ihm bleibt. Und dass sie miteinander alt werden. Er seufzt.
„Wir warten noch einen Augenblick, dann nehmen wir Kontakt mit der Mobility auf. Schau, die anderen warten auch auf ihre Kinder.“ Und tatsächlich aus vielen Häusern treten Menschen vor die Türen. Die Realität-Brillen schaukeln an ihren hakeligen Fingern. Hände, Schultern und schwere Luft senken sich zum Boden, unterspülen die Stille, die sich über der sommerlichen Idylle ausbreitet.
Ein Rascheln dringt in die andächtige Angst. Vervielfacht sich. Eine Bewegung an der Ecke des Centers. Und ein kollektives Ausatmen. Die Kinder kommen. Ein Schreien erhebt sich über dem ehemaligen Feld mit der Akademikersiedlung, der Pulk löst sich voneinander und einzelne Kinder laufen über die Wege zu Ihren Häusern.
„Der Bus hat uns herausgelassen.“
„Er hat gebremst.“ „Da war ein Mann und eine Frau.“ „Der Bus hat Gas gegeben, dann ist er explodiert.“
„Er ist gegen die Wand gekracht.“
Marta und Gunnar ziehen ihre Kinder ins Haus, helfen ihnen aus den Rücksäcken, bringen das Gespräch auf die Schulwoche, erkundigen sich nach der Lieblingslehrerin.
„Das wird sich schon aufklären, mit dem Bus.“ Die Kinder nicken, sie haben gelernt ihre Emotionen einzufangen.
„Wir haben Hunger!“
„Die ganze Fahrt habe ich mich auf Pfannkuchen gefreut.“
„Was gibt es zu essen?“ Gunnar schreibt sich Zettel mit seiner Frau, während das Plaudern der Familien kontinuierlich weiter plätschert.
‚Rettungsprogramm mit VIVA wurde im Parlament beschlossen‘
‚zwei Wissenschaftler werden vermisst, ich kenne sie‘
‚Du denkst, die im Bus?‘
‚sie sind auf der Flucht‘ ‚sie könnten rekrutiert worden sein, für das Programm‘ ‚Du denkst sie wollen zu Dir?‘ Gunnar nickt und wendet den Pfannkuchen, Marta trägt die geknüllten Zettel zum Ofen und hält ein Streichholz daran.
Der Hund schlägt an. Der Collie läuft vorne ins Haus, blockiert Gunnar, der auf dem Weg in die Küche ist, umrundet den Tisch und die Familie und läuft zum Wohnzimmer wieder hinaus. Gunnar folgt ihm.
„Können wir mit?“, rufen die Mädchen. Sie sehen müde aus. Immer sehen sie müde aus nach der Schulwoche.
„Ihr bleibt hier!“ Gunnar erschreckt vor der Härte in seiner Stimme. Der Hund führt ihn zum Wasser. Und will weiter zum Nachbarn, Gunnar pfeift ihn zu sich. Er schaut sich unauffällig um, geht auf den Steg und setzt sich an das äußere Ende. Der Hund schnüffelt unter dem Findling und kommt dann neben Gunnar auf den Steg. Hinter seinem Rücken wird es still. Zwei Menschen sind auf der Flucht, sie waren hier bei ihm, aber sie sind weitergezogen. Gunnar schöpft eine Handvoll Wasser und verwischt seine Tränen mit dem Meerwasser. Ein achtzigjähriger im Körper eines fünfzigjährigen. Er fühlt die Kraft seines Körpers und die Müdigkeit in seinem Geist. Die Wiederholung von Erleben und Erkenntnis zermürbt seine Seele.
Nein, seine Lebenslüge verstopft ihm den Esprit. Ja, er kann nicht mehr ändern, was er möglich gemacht hat. Er hätte VIVA verhindern können, die Ernte vernichten, dafür sterben können, was ja durchaus angemessen ist für einen Menschen. In Lissabon vor fast genau einem viertel Jahrhundert hat er versagt. Er ist gescheitert, mit seinen Fähigkeiten an seinen Fähigkeiten. Er ist erbärmlich.
Gunnar steht auf und springt ins Wasser. Der Hund winselt, er bleibt auf dem Steg. Er denkt, er kann nicht schwimmen.
Die Luft ist voll mit Helikoptern und Drohnen. Hundestaffeln durchstreifen das Küstenvorland mitsamt den Gärten, Gunnar steht inzwischen wieder am Steg. Er hat die Kinder vom Haus abgeholt.
„Es muss jemand hier gewesen sein, der Hund hat angeschlagen.“ Der Soldat nickt. Die Kinder haben noch nie Soldaten gesehen. Das humanoid-roboterhafte ist grotesk. Das, die vom Hund gewitterte Gefahr und die Bussache wird die Erregungsimpulse in ihren Chips erklären. Alle fünfzig Meter wird ein Soldat postiert, die anderen ziehen zügig weiter. Ein Spürhund mit Führer läuft schräg über das Nachbargrundstück und gut zehn Meter an ihnen vorbei zum Spülsaum und um den Findling herum. Der Hund kläfft, er will ins Wasser. Der Mann entledigt sich seiner Kleider und folgt dem Hund ins Meer. Der Hund schwimmt einen Kreis, bellt wieder und zeigt die verlorene Spur an.
Gunnar kann sich nicht erinnern, wann es hier jemals einen solchen Aufruhr gab. Lieber ins Wasser, als ewig bleiben, kann vielleicht die offizielle Interpretation werden.
„Lass uns zum Haus zurückgehen. Wir können später baden, wenn sich die Lage beruhigt hat. Gunnar friert.
„Papa, Du warst ja schon schwimmen“, bemerken die Kinder.
ENDE

Ronja Katharina Quentin
muss nicht lange überlegen, als wir sie nach ihren Steckenpferden und Zukunftsplänen fragen. Aufgrund ihrer Leidenschaft, Geschichten zu schreiben, liest sie auch viel und gerne. Außerdem sind ihre schulischen Favoriten-Fächer Deutsch, Biologie und Geschichte. In der Freizeit ist sie auch gerne mit Tieren zusammen, woraus sie bereits ein Studium in Veteri-närmedizin ins Auge gefasst hat.
Lesen Sie ihren besonders ausgewählten Aufsatz:
Träume sind auch Wege zur Realität
(Urheberrechte und Copyrights by Ronja Katharina Quentin)
Mein Name ist Elin und seit meinem 5. Lebensjahr sitze ich im Rollstuhl, weil ich eine Infektion in meinen Beinen hatte, welche sich in den Knochen ausgebreitet hatte. Damals mussten sie mir die Beine amputieren, um die Infektion zu stoppen.
Mein größter Wunsch ist seitdem, dass ich irgendwann mit Prothesen wieder laufen kann. Das Problem ist, dass Prothesen sehr teuer sind und meine Eltern sie sich nicht leisten können. Ich habe allerdings eine weitere Leidenschaft und das ist das Schreiben von Geschichten. Mich in andere Welten zu träumen, in welchen am Ende ein Happy End steht.
Ein Verlag hat nun allerdings angefragt, ob ich nicht einmal meine Geschichte aufschreiben möchte. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, denn diese Geschichte wäre anders als meine vorigen. Sie hätte kein Happy End also jedenfalls kein großes. Ich weiß, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich noch lebe. Denn die Infektion hätte sich bis zu meinem Herzen ausbreiten und mich töten können. Aber ich würde so gern mal wieder schwimmen oder laufen. Einfach über eine Blumenwiese laufen, das ist einer meiner größten Wünsche. Für andere ist das normal und sie denken darüber nicht einmal nach. Sie wissen es nicht zu schätzen, was es heißt, laufen zu können. Jedenfalls hadere ich sehr mit mir, meine Geschichte öffentlich zu machen.
Heute ist meine Tante Irin zu Besuch und ich nutze einen stillen Augenblick, um mit ihr zu sprechen. „Du Irin, was würdest du eigentlich sagen, wenn ich eine Biografie veröffentlichen würde. Also darüber schreibe, wie es ist ein Leben ohne Beine führen zu müssen?“
Irin überlegte kurz bevor sie antwortete, „Elin, ich glaube, das musst du selbst herausfinden. Wenn du deine Geschichte für dich behalten willst, solltest du genau das tun. Aber ich denke, es würde anderen Jugendlichen, die in einer ähnlichen Situation sind, helfen. Überleg nur mal, wie oft du dich fragst, wie dein nächster Schritt aussehen soll. Du könntest anderen helfen und ein Vorbild sein, aber nur wenn du dich damit wohlfühlst.“
Ich dachte viel über diese Worte meiner Tante nach und entschloss mich dann meine Biografie zu schreiben. Mit ein paar Änderungen und mit andern Namen aber ich schrieb sie und ein paar Monate später wurde sie veröffentlicht. Einige Wochen nach der Veröffentlichung erreichte mich eine E-Mail von einem Mann, der sich als Riley Larson vorstellte, in seiner E-Mail schrieb er, dass er meine Geschichten sehr gern liest und meine Biografie ihn sehr berührt hat. Dass er eine Firma besitzt, welche Prothesen herstellt, und dass er mir gern eine sponsern würde. Ich solle mich bei ihm melden, wenn ich einwilligen würde. Ich rollte so schnell es mit dem Rollstuhl ging zu meinen Eltern und erzählte ihnen davon. Weil sie es nicht glauben konnten, zeigte ich ihnen die E-Mail und sie freuten sich sehr für mich. Ich wusste, dass sie sich schuldig fühlten, weil ich im Rollstuhl sitze und sie sich die Prothese nicht leisten können. Ich schrieb also zurück, dass ich mich sehr freue und dieses großzügige Angebot zu schätzen weiß. In der Antwortmail, die daraufhin von Riley Larson kam, schlug er einen ersten Termin zur Beratung vor. Ich war mehr als aufgeregt. Denn dieser Termin würde mein Leben verändern. Dieser Termin ist heute und ich bin unglaublich aufgeregt.
Die Fahrt zu dem vereinbarten Treffpunkt kam mir so vor, als würde die Zeit zum Stehen kommen und immer wieder fragte ich, wie lange wir denn noch brauchen würden. Meine Eltern schmunzelten nur, sagten aber nichts. Sie verstanden, dass ich so aufgeregt war. Endlich angekommen begleitete uns eine Frau zu einem Büro im Untergeschoss und verabschiedete sich mit den Worten, „Mister Larson und Mister Kayn kommen gleich.“ Ein paar Minuten später ging die Tür wieder auf und zwei Männer betraten den Raum. Der eine hochgewachsen und blond, der andere schon etwas betagt und in einen weißen Kittel gekleidet. Der hochgewachsene blonde schüttelte meinen Eltern die Hand und stellte sich als Riley Larson vor. Den anderen Mann nannte er Will. Dieser erklärte uns, dass er Leiter der Forschungsabteilung für Beinprothesen sei und gelernter Orthopädie Technik Mechaniker. Er stellte sich als Doktor Wilbert Kayn vor. „Nun zuerst einmal, natürlich müssen Beinprothesen immer an den jeweiligen Träger angepasst werden, aber wir haben ein paar Standardmodelle. Wir müssen also schauen, welche du verträgst und dann mit welchen du besser klarkommst“, erklärte Dr. Kayn. „Das wird aber alles bei den folgenden Terminen kommen. Heute ist erst mal nur ein Beratungstermin. Wir erklären dir alles und sprechen ab, was wann passieren wird“ unterbrach Riley Larson ihn.
Die beiden Männer setzten sich und zeigten uns erst einmal ein paar Bilder von Prothesen. Dr. Kayn erklärte mir bei jeder einzelnen die Vor- und Nachteile, die damit verbunden sind. „Nun möchte ich dir erklären, wie das ganze ablaufen wird“, sagte Riley Larson …, „also zunächst werden jetzt ein paar Termine bei Will folgen. Sie werden testen, welches Material deine Haut am besten verträgt. Anschließend wird überprüft, welche Prothese am besten zu deinen Stümpfen passt. Nach diesen Tests werden wir eine anfertigen, die entsprechend den Vorgaben genau an dich angepasst wird. Wenn die Prothese fertig ist, musst du ein paar Monate in eine Reha, in der du lernen wirst, wie du die Prothese benutzt, und in der ein Muskelaufbautraining stattfinden wird, um die Muskeln aufzubauen, die du zum Laufen brauchst. „Hast du noch Fragen oder Sie“, damit wandte er sich an meine Eltern, welche die meiste Zeit nur stumm da gesessen hatten. Ich schüttelte den Kopf. Doch meine Mutter fragte: „Wie lange dauert dieser Prozess denn ungefähr? Sie muss ja auch in die Schule. Bei den voran gehenden Terminen ist das ja alles kein Problem. Aber bei der Reha -“ Riley Larson nickte „Ja, diese Frage ist berechtigt.
Das zu erwähnen hatte ich vergessen, dieses Reha-Zentrum, welches anbei bemerkt zu dieser Firma gehört, ist mit einer Schuleinrichtung verbunden, da wir öfter Minderjährige oder zumindest noch zur Schule gehende Patienten haben. Die Schule ihrer Tochter wird dem dortigen Lehrpersonal Aufgaben und Lernstand ihrer Tochter mitteilen und die Lehrer in der Reha werden ihrer Tochter bei den Aufgaben helfen und den Unterricht, solange der Aufenthalt dauert, durchführen“. Meine Mutter nickte und lächelte. Auch mein Vater stellte keine weiteren Fragen. Riley Larson und Dr. Kayn verabschiedeten sich und meine Eltern verließen mit mir das Büro. Auf der Heimfahrt bemerkte ich erst wie lange das Gespräch gedauert hatte, denn es begann schon zu dämmern. Aber ich war glücklich. Mein Traum würde in Erfüllung gehen. Einige Tage später fuhren meine Mutter und ich wieder zu der Firma, welche übrigens RLP hieß. Beim Empfang erwartete uns schon Dr. Kayn. Er führte uns in einen Untersuchungsraum. Auf einem Tisch lagen verschiedene Socken ähnliche Stofffetzen. Dr. Kayn erklärte uns, dass diese dazu da seien, den Stumpf zu schützen, damit keine Entzündungen oder ähnliches durch die Prothese entstünden.
Ich probierte sie also an und entschied mich dann für einen aus Baumwolle, der in einem beigen Ton gehalten war. Dr. Kayn notierte das auf einem Blatt und maß dann noch die Enden meiner Beine knapp unter meiner Hüfte. Auch diese Daten wurden auf dem Blatt vermerkt. Dann war der Termin schon wieder vorbei und meine Mutter und ich fuhren nach Hause. Die nächsten Termine verliefen ähnlich, bis schließlich einmal eine längere Pause zwischen den Terminen lag. Dr. Kayn erklärte uns, dass jetzt die Prothese angefertigt würde und beim nächsten Mal die Anpassung sei, bei der auch Riley Larson wieder anwesend sein würde. Dem entsprechend fieberte ich diesem Termin entgegen. Ich redete beinahe von nichts anderem mehr.
Ich zählte die Stunden. Meine Eltern freuten sich mit mir. Sie waren froh, mich so fröhlich und aktiv zu erleben. Dann endlich war es so weit. Mein Vater half mir ins Auto und wir fuhren los. Bei dem Firmenkomplex angekommen half mein Vater mir in den Rollstuhl und wir begaben uns voller Vorfreude zum Eingang von RLP. Dort wartete der Inhaber und Geschäftsführer Riley Larson persönlich auf uns.
Er begrüßte mich wie eine alte Freundin und bat uns herein. In dem Raum, den wir ansteuerten befand sich eine Ballettstange und auch eine Liege. Dr. Kayn war bereits da, er begrüßte mich und bat meinen Vater, mir zu helfen mich auf die Liege zu setzten. Dann nahm er meine Prothese vom Tisch hinter sich und zeigte sie mir. Er erklärte auch noch einmal alles ganz ausführlich. Dann war es endlich so weit. Er reichte mir den Überzug aus Baumwolle, welchen ich mir ausgesucht hatte. Dann erklärte er mir, während er es an einem Modelle vorführte, wie ich die Prothese anziehen und befestigen musste. Anschließend reichte er sie mir und ich machte mich daran, sie genauso anzuziehen wie Dr. Kayn es demonstriert hatte. Ein bisschen umständlich aber immerhin machte ich das ja zum ersten Mal. Der Doktor erklärte mir noch ein paar Sachen, bevor er mir in den Rollstuhl half, mit dessen Hilfe ich zu der Ballettstange gelangen würde. Dann sagte er, „du hast viel Kraft in den Armen, aber so gut wie gar keine in deinen Beinstümpfen. Deshalb musst du dich auch jetzt, wo du die Prothesen anhast, auf die Kraft in deinen Armen und nicht auf die Prothesen verlassen. Davon abgesehen, dass du vermutlich dein Gleichgewicht nicht halten könntest. Also zieh dich an der Ballettstange hoch und stemme dich auf deine Arme. Lass dann langsam mehr Gewicht auf die Prothesen und deine Beine kommen. Wenn es zu viel wird, sag lieber einen Moment früher als später Bescheid, ich möchte nur sehen, ob alles richtig eingestellt ist.“ Ich tat wie mir geheißen und merkte schnell, was Dr. Kayn meinte, als er auf die fehlende Kraft in den Beinstümpfen hinwies. Ich war in den Armen ohne Frage kräftig. Ich musste ja auch in meinen Rollstuhl kommen, wenn keiner da war, der mir helfen konnte. Aber das Gewicht langsam auf die Prothese zu übertragen, war viel kraftaufwendiger und so musste ich schon nach wenigen Augenblicken Bescheid sagen und mich in den Rollstuhl gleiten lassen. Jetzt merkte ich auch, dass Riley Larson mit seinem Handy ein Video davon gemacht hatte und mit meinen Eltern besprach, wie er es ihnen schicken sollte. Meine Aufmerksamkeit richtete sich wieder auf Herrn Kayn, der mich lobte, dass das sehr gut gewesen sei. „Den Rest also Muskelaufbau, Gleichgewicht und Co. werden sie dir in der Reha beibringen“, sagte er bevor er sich verabschiedete. Riley Larson sprach jetzt noch an, wie der Reha Aufenthalt genau ablaufen würde und wann ich dort hinfahren könnte.
Zwei Tage nach diesem Ereignis stiegen meine Mutter und ich wieder ins Auto. Meine Taschen lagen gepackt im Kofferraum neben meinem Rollstuhl. Meine Mutter würde mich in die Reha fahren und die erste Nacht dort bleiben, dann aber wieder nachhause fahren und an den Wochenenden kommen so weit es ihr möglich sein würde. Ich war sehr aufgeregt. Das Zimmer, in das wir nach unserer Ankunft geführt wurden, war ein Gästezimmer, erklärte uns die Hausmutter. Wenn meine Mutter wieder nach Hause fuhr, würde ich auf ein Zwei-Bett-Zimmer mit einem andern Mädchen kommen. Doch nun waren wir erst einmal gemeinsam hier.
Das Reha-Zentrum liegt in Emden, weil auch die Seeluft heilsam sein soll. Am nächsten Morgen, bevor meine Mutter wieder losfuhr, wollten wir unbedingt noch das Meer sehen. Also fuhr meine Mutter mit mir zu einem Strand-Café, das ein wenig außerhalb lag. Wir verbrachten ein paar schöne Stunden zusammen. Selten hatte ich sie so entspannt erlebt wie hier. Doch auch die schönste Zeit ist mal vorbei und so musste sie sich nach der Rückkehr zur Reha leider verabschieden. Die Hausmutter Brigitte Iseling führte mich zu meinem „neuen“ Zimmer. Meine Zimmergenossin war auch da und Miss Iseling ließ uns einen Moment allein, während sie meine Sachen holte. Das Mädchen saß am Fenster. Jetzt drehte es sich um. „Hallo“, sagte sie. „Mein Name ist Ava. Wie heißt du?“ „Mein Name ist Elin und ich bin hier, weil ich Prothesen bekommen habe.“ Während ich das sagte, deutete ich auf meine Stümpfe. Das Mädchen, Ava, lächelte „Ich bin wegen meines rechten Armes hier. Er musste auch amputiert werden und ich soll lernen, damit umzugehen. also mit der Prothese“ sagte sie. In diesem Moment kam Miss Iseling wieder herein. Sie zeigte mir meinen Schrank, der niedrig und dafür in die Länge gezogen war, sodass ich an alles bequem auch vom Rollstuhl aus dran kam. Meine Taschen stellte sie auf den Tisch in der Mitte des Zimmers, dann ging sie und schloss die Tür. Ava hatte sich wieder dem Fenster zugewandt und ich machte mich daran meine Sachen einzuräumen.
„Wie ist das passiert?“, fragte Ava plötzlich wieder. Ich erzählte ihr meine Geschichte und sie mir ihre. Sie hatte einen Bruder, er war schon 18 und durfte Auto fahren. Leider kam es zu einem Unfall, bei dem Avas Arm so stark eingequetscht wurde, dass man ihn nicht retten konnte. In den nächsten Tagen wurde Ava zu einer guten Freundin und wir scherzten viel zusammen. Sie half mir beim Lernen und ich ihr beim Schreiben, wenn sie etwas noch nicht wieder ganz hinbekam. Ab und zu hatte ich abends starken Muskelkater, aber ich war glücklich. Ich hatte eine Freundin, lernte laufen und meine Eltern mussten sich keine Vorwürfe mehr machen, dass ich nicht dieselben Chancen wie andere hatte.
Drei Wochen waren vergangen und ich konnte schon einige Schritte mit Krücken laufen, aber die Physiotherapeutin und auch Miss Iseling verboten mir es allein zu tun. Weil sie sich sorgten, dass ich hinfallen könnte. Doch ich wurde mit jedem Tag sicherer. Ich war mir sicher, dass ich auch meinem Traum vom Laufen über eine grüne Blumenwiese jeden Tag näher kam. Leider hatte ich heute Rückschläge gemacht. Meine Physiotherapeutin meinte, es sei ganz normal, dass ich nicht jeden Tag weitere Strecken laufen konnte und dass sich meine Beine schließlich erst an die Prothesen gewöhnen müssten, aber ich war niedergeschlagen. Ava versuchte mich aufzumuntern, was ihr nur mäßig gut gelang. Irgendwann blinkte an meinem Rechner das Symbol für eine neue Mail auf und ich rollte zum Tisch „Oh ich habe eine E-Mail von meiner Mutter bekommen“ stellte ich verwundert fest. Ava kam zu mir. „Schau, da ist was angehängt“, sagte sie. Als ich den Anhang anklickte, erkannte ich mich selbst. Es war das Video das Riley Larson bei meinem ersten Versuch mit den Prothesen gemacht hatte und als ich das sah und mich dann an heute Vormittag erinnerte, sah ich, was für ein Weg schon hinter mir lag und das in gerade mal drei Wochen.
Jetzt war ich wieder motiviert. Ava und meine Physiotherapeutin hatten recht, ich war bis jetzt schon weit gekommen und Rückschläge gehörten zum Vorankommen dazu. Den restlichen Tag lernte ich mit Ava für einen Test, der morgen anstand. So ging das auch in den nächsten Wochen weiter mal Rückschläge aber meistens Vorankommen mit den Prothesen. Nach fast 5 Wochen erlaubte mir meine Physiotherapeutin, die ich Emilia nennen durfte, auch in meinem Zimmer und in den Parkanlagen des Reha-Zentrums die Prothesen zu tragen, wenn jemand dabei war. Ich freute mich sehr und nahm mir vor gleich am Nachmittag mit Ava einen langen Spaziergang zu machen. Doch als ich im Zimmer ankam, erwartete mich jemand, mit dem ich nicht gerechnet hatte. „Hallo Mr. Larson“, sagte ich, während ich die Tür hinter mir schloss. Riley Larson lachte und sagte ich solle ihn Riley nennen und dass er einmal schauen wolle, wie die Prothesen funktionierten.
„Ich habe heute die Erlaubnis bekommen, dass ich sie auch draußen tragen darf, solange jemand dabei ist, und sie sind jemand, also schlage ich vor, sie begleiten mich auf einem kleinen Spaziergang durch den Park und ich erzähle ihnen alles. Anbei können sie sich dann auch selbst überzeugen“ er nickte und so zog ich die Prothesen, inzwischen mit geübten Griff, an und zog mich hoch. Er bot mir, wie ein Gentleman in den alten Filmen, den Arm an und wir gingen hinunter in den Park. Ich erzählte ihm alles, was ich erlebt hatte, und wie glücklich ich war, dass ich diese Chance von ihm bekommen hatte. Er freute sich sichtlich, dass ich mich so sehr freute und als wir wieder in meinem Zimmer waren, lächelte er. „Ich freue mich sehr, dass ich dir helfen konnte, deinem Traum ein Stück näherzukommen, und wenn ich das so sagen darf, du bist dabei deinem Traum in Kilometer-Schritten näherzukommen“ ich lächelte und Riley verabschiedete sich bald darauf.
Nach weiteren 6 Wochen war es so weit. Emilia befand, dass ich sicher genug auf den Prothesen war, um mit ihnen auch in heimischer Umgebung zurechtzukommen. Mein Aufenthalt in der Reha würde also schon bald vorbei sein. Doch auch Ava hatte gute Nachrichten, sie würde nach Hause zurückkehren. An meinem letzten Tag überraschten mich meine Eltern, meine Tante Irin und Riley Larson. Sie hatten einen Aufenthaltsraum schön geschmückt und wollten mit mir ein bisschen feiern. Ich holte auch Ava dazu und wir verbrachten einen schönen Nachmittag zusammen. Doch das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss und so auch diesmal, denn meine Eltern überreichten mir einen Umschlag, den ich gespannt aufriss. Darin lag eine Karte auf der stand, wir mit dir in Tirol, deine Eltern. Ich hob den Blick und schaute sie an. „Ist das euer Ernst?“, keuchte ich schließlich und sie nickten. „Wir haben in den letzten Jahren immer wieder etwas zurückgelegt um dir eines Tages doch eine Prothese finanzieren zu können und da das nun Herr Larson übernommen hat, haben wir das Geld dafür verwendet, dir die andere Hälfte deines Traums zu erfüllen. Eine Tiroler Berglandschaft entspricht doch sehr dem Bild eines Mädchens, das über eine grüne Blumenwiese läuft, oder?“ erklärte mein Vater. Ich jubelte und fiel ihnen um den Hals. „Danke“, flüsterte ich.
Vier Tage später, als ich aus der Reha und wieder zu Hause war, fuhren wir also nach Tirol, um meinen Traum nun endlich zu erfüllen, und es war mein Traum. Es waren wunderschöne Wiesen und andere Landschaften in den Tiroler Bergen und ich war einfach nur noch glücklich an diesem Punkt zu stehen und da zu sein. An einem Nachmittag als es mal regnete, schrieb ich eine Mail an Riley:
Hallo Riley,
dieser Urlaub mit meinen Eltern ist der Wahnsinn, ich bin so glücklich, dass mein Traum durch deine Hilfe nun endlich in Erfüllung gehen konnte. Ich hatte damals die Hoffnung schon fast aufgegeben. Du hast mich wieder daran erinnert, dass auch Träume nur ein Weg ist, die Realität so zu verbiegen, dass man schließlich den richtigen Weg findet. Jedenfalls vielen Dank, dass du mir das zu erleben und zu verstehen geschenkt hast. Ich werde dir ewig dankbar sein und wenn es etwas gibt, was die Zeit und Ewigkeit überdauert, dann sind es Träume, die einen zum weiter Kämpfen bewegen und die Nächstenliebe, die sie Wirklichkeit werden lässt.
In ewiger Freundschaft.
Elin
ENDE
Ben Berlin bereichert diese Rubrik mit vier
Auftritten in vier verschiedenen Anthologien.

Ben Berlin, Jahrgang 1985, studierte Germanistik und Philosophie an der FU-Berlin und der HU-Berlin sowie Journalistik und Public Relations an der FJS-Berlin.
In Cottbus geboren, lebt er jetzt seit vielen Jahren in seiner Wahlheimat Berlin. Nach einigen Stationen als freier Journalist, Volontär in Verlagen, Texter, Lektor, Korrekturleser und der Mitarbeit an journalistischen Onlineblogs, widmet er sich derzeit als freiberuflicher Schriftsteller der Veröffentlichung diverser Kurzgeschichten sowie seines Debütromans DIE UNERTRÄGLICHE ZERBRECHLICHKEIT DES SEINS (in der Manuskript-Phase).
"Zu Schreiben hat mir nach dem frühen Tod meines Vaters geholfen, dieses einschneidende Erlebnis zu verarbeiten. Als ich bemerkte, welches Potenzial in den damals entstandenen Geschichten steckte, ergriff ich die erstbeste Gelegenheit, mich als Schriftsteller selbstständig zu machen."
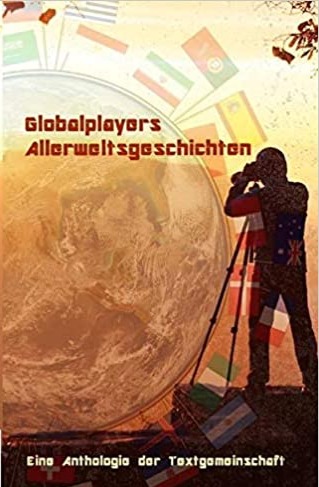
Lesen Sie als Auftakt aus der
Anthologie:
GLOBALPLAYERS ALLERWELTSGESCHICHTEN
den Beitrag von Ben Berlin:
DER KOFFERRAUM
(Hier die Leseprobe)
Joey öffnete den Kofferraum mit einem beherzten Ruck und es verschlug ihr augenblicklich den Atem. Ganz automatisch fuhr ihr die Hand zum Mund.
„Ich hab doch gesagt, dass du die Finger vom Kofferraum lassen sollst!“, rief Armin.

»Schmunzelmord! 25 kriminelle Kurz-geschichten aus dem Münchner Norden … und von anderswo «
Kriminell. Kurzweilig. Sympathisch.
Verbrechen wollen unterhalten. Dafür wird schon einmal ein Mord am malerischen Schleißheimer Schloss begangen oder erfährt der Koffer-Klau am Franz-Josef-Strauß-Flughafen eine unerwartete Wendung. Vor allem im Münchner Norden tobt das Verbrechen. Vom Handtaschenraub über Versicherungsbetrug reicht die Palette bis zum Totschlag. In 25 Kurzkrimis verüben liebenswerte Figuren Straftaten, werden Opfer oder klären auf. Jeder Fall ist anders, er lässt den Leser schmunzeln oder treibt ihm die Tränen des Mitgefühls in die Augen. Die Kürze bietet Lesevergnügen auch für zwischendurch, ...
»...aber es wird selten bei nur einer Geschichte bleiben.« (FORUM München Nord)
»Kothe lässt einen nicht mehr los.« (Forum München Nord)
Mehr Information auf: https://das-buch-schmunzelmord.jimdosite.com
oder auf der Autorenhomepage: https://autor-michael-kothe.jimdofree.com.

»Quer Beet aufs Treppchen 2200/21«
(Aus dem Klappentext)
“Der Anblick war wirklich nicht schön. Dazu kamen süßlicher Verwesungs-geruch und ein Hauch von Desinfektionsmitteln. Durch hektisches Schlucken konnte ich eben noch verhindern, dass sich der Geruch nach Erbrochenem dazugesellte. Beide Leichen lagen ..., in dieser Geschichte grausam zugerichtet auf einer Yacht. In anderen: Eine erpresserische
Kindesentführung, ein Mord im Winterwald – ohne Leiche, ein dramatischer Ausbruch aus der täglichen Routine. Oder der Schatz am Ende des Regenbogens, die Romanze, die zum Albtraum wird, und die, die glücklich endet ... Doch wieder ist nichts, wie es scheint!
Wieder stellen sich ehrgeizige Erzählungen und Lyrik in Literaturwettbewerben oft erfolgreich dem Urteil der Jury aus Autoren, Verlegern und anderen Literaten, wieder schreibt sich der Autor
durch unterschiedlichste Genres.
»Der [Autor] ist beim Schreiben vielseitiger als ich beim Lesen!«,
urteilt die Bloggerin Rezensionsnerdista.de.
Und »eine gut gefüllte Wundertüte« rezensiert ein Bibliotheksmitarbeiter den ersten Band der
Reihe. Mehr Information auf:
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com
sowie:
https://das-buch-quer-beet.jimdosite.com.
Auszugsweise eine Kostprobe aus obigem Werk von Michael Kothe:
Marion wieder besser v***** können!
Gerade habe ich meine Mailbox geöffnet, und da steht sie ganz oben, diese Nachricht. »Marion wieder besser …« Woher wissen die? Unwillkürlich fährt mein Blick an mir hinab, bis er … Nein, ich sehe nichts Ungewöhnliches, denn die Platte meines Computertisches verhindert, dass ich tiefer blicken kann als bis zum Hosenbund meines Wellnessanzugs. Jetzt im Homeoffice leiste ich mir das Tragen legerer Kleidung.
Meine Mundwinkel ziehen sich auseinander, als der Mauszeiger über die Absenderadresse fährt. Natürlich! Offenbar eine Online-Apotheke, ihre Mail-Adresse endet auf ».uk«. Woher kennen die meinen E-Mail-Account? Und wie kommen die darauf, dass ich …? Mein Schmunzeln friert in meinem Gesicht ein, als mir diese Gedanken kommen. Eine Frechheit! Es ist nicht die erste Mail dieser Art, die ich erhalten habe, bisher habe ich alle ungeöffnet weggeklickt. Aber momentan …, ein Blick aus dem Fenster ins winterliche Grau sagt mir, dass ich ein wenig Aufheiterung brauche, einfach Ablenkung, bevor ich mich in die Bearbeitung meiner beruflichen Mails stürze.
Ich nippe an meinem Morgenkaffee und stelle die Tasse wieder neben die Tastatur. Immer noch zu heiß! Der Mauszeiger hängt schon über der ersten Arbeitsmail.
»Ach, komm schon«, sagt das kleine Teufelchen in meinem Hinterkopf, »so viel Zeit hast du.« Mit einem »Denk an Marion!«, heimst es einen Sieg über das Engelchen ein, das pünktlich die Arbeit an meinem Heimarbeitsplatz beginnen will. Ich öffne die Mail! Obwohl der Absender offensichtlich im Vereinigten Königreich residiert, ist der Text auf Deutsch. Wie erwartet – ich grinse breit – dreht sich der Inhalt der Nachricht um kleine hellblaue Pillen. Ihre Einnahme verspricht die gesteigerte Durchblutung eines gewissen Körperteils. Betroffen fühle ich mich nicht. Klar, überlege ich, keinem Menschen gefällt es, wenn er auf eine Beeinträchtigung seiner Fähigkeiten hingewiesen wird. Aber genau durch diesen Abwehrgedanken hat die Mail meine Neugierde geweckt. Die Arbeit kann warten, mein Chef sieht mich ja nicht!
Wikipedia bietet mir seitenweise Information. Wissen, das die Welt nicht braucht. Welchen Mann interessiert, dass das Medikament von Pfizer stammt, wenn er es doch nicht beim Hersteller kauft? Sildenafil als Wirkstoff ist zwar kein Zungenbrecher, aber nach dem ersten Lesen schon wieder vergessen. Da ist die vasodilantierende, also die gefäßerweiternde Wirkung lautmalerisch schon anspruchsvoller. Willkommener als lateinische Fachbegriffe zieht mich weiter unten im Text der Abschnitt Nicht-medizinische Verwendung an, und noch viel besser finde ich die Bedeutung des Handelsnamens. Nach einem ersten Auflachen besinne ich mich, dass gerade diese Assoziation zu raubtierhafter Stärke vielen Menschen Hilfe bei ihren Problemen versprechen möchte. Und so kommt mir die Mail mit ihrem Angebot wieder in den Sinn. Einfach mal ausprobieren, unverbindlich natürlich? In wie vielen Lesern weckt es Hoffnung? Mich hat die Neugier nun fest im Griff. Ein Stichwort reiht sich ans andere, und schon bin ich auf der Jagd nach Links und Hyperlinks, die mich fesseln. Die Texte sind verständlicher als der erste von Wikipedia, die Probleme und Lösungen werden mehr in Umgangssprache abgehandelt.
Beim Scrollen fällt mein Blick auf die kleine digitale Uhr in der rechten unteren Bildschirmecke. Es ist wirklich Zeit, mit meiner Arbeit zu beginnen. Ich kann ja später noch einmal …, mit einem Seufzer schließe ich sämtliche Browserfenster bis auf mein Mail-Programm.
Ich zucke zusammen, als ich in dem Moment eine Bewegung hinter mir spüre. Erschrocken schaue ich über meine Schulter. Meine Lebensgefährtin Simone beugt sich über mich und liest auf dem Bildschirm mit.
»Marion, mach´s weg!«, meint sie bloß. «Mit Viagra haben wir nichts am Hut.«
Brand-new from Sophie Kinsella:
LOVE YOUR LIFE
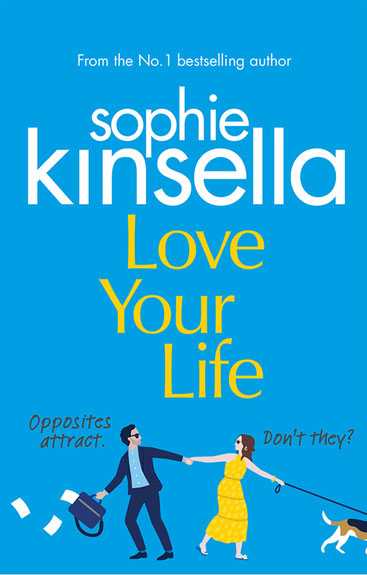
sophie’s introduction
Hello! I’m absolutely thrilled to reveal that I’ve been working on a brand new book! It’s coming later this year (27th October in the US/Canada and 29th October in the UK) and it’s called LOVE YOUR LIFE.
I hope it makes you smile, escape and even laugh. Click the links below to find out more about the book and to find out how to pre-order it.
And if you’re not in the UK/US/Canada then keep checking back here to find out when Love Your Life will be out in your country.
I really hope you enjoy it and hope everyone is well.

Sophie Kinsella hat viel zu bieten, schauen Sie rein und besuchen Sie Ihre Homepage!
https://www.sophiekinsella.co.uk/

Michael Kothe, Jahrgang 1953, Diplomkaufmann und Wirtschafts-jurist, jonglierte über 30 Jahre lang von Berufs wegen mit Worten auf Deutsch und Englisch. Davon leben heute seine Geschichten und Romane. Verantwortungsbewusst-sein Partnern und Kunden gegen-über nimmt er ernst. Früher waren das in nationalen und internatio-nalen Rüstungsprogrammen die Industrie, Ämter und Ministerien, heute sind es seine Leserinnen und Leser.
Seinen
Ruhestand verbringt er teils bei München – mit den Tatorten seiner Krimis vor der Haustür – und, teils in Galizien, dem grünen Norden Spaniens,
wo er sich vorwiegend seinen Fantasyromanen widmet. Regelmäßig nimmt er mit Kurzgeschichten aus allerlei Genres an Wettbewerben teil. Auf diese Weise sind zahlreiche bestplatzierte Beiträge nach
ihrer Veröffentlichung in seine eigenen Anthologien eingeflossen.

»Gut gefüllte Wundertüte«.
Wie liefere ich einen Mörder aus - ohne Beweise und ohne mich zu erkennen zu geben? Was führt die düstere
Babysitterin im Schilde? Hat der Gast immer Recht? Rettet der tollpatschige Raumfahrer die Menschheit? Warum kann ein Todesurteil erst nach 19 Jahren vollstreckt werden? Und war da nicht auch
noch ein vergnüglicher Mord am Frühstückstisch? u.v.m.
Schauen Sie herein bei:
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com
https://das-buch-quer-beet.jimdosite.com
Hier eine Leseprobe aus QUER BEET AUFS TREPPCHEN
DIE HÖHLE
Urheberrechte & Copyrights by Michael Kothe
Angst. Namenlose Angst. Anfangs hielt sie sich leicht über mich gebeugt. Mit der Zeit lernte sie, wie sie mich zur Verzweiflung brachte. Schwer presste sie sich auf mich, drückte mir die Augen zu, kroch mir in Mund und Nase und schnürte mir den Atem ab. Sie setzte sich mir auf die Brust, auf Arme und Beine und verbot mir, mich zu bewegen.
Kurz vor dem Ersticken bäumte sich mein Körper auf, ich schrie. Sand und Erde spürte ich im Rachen, ich würgte sie aus. Dämmerlicht nahm ich wahr, mein Bewusstsein kehrte zurück. Mein Körper fühlte sich geschunden an, Verletzungen stellte ich aber nicht fest. Die Erkenntnis über meine Umgebung jedoch versetzte mir einen bodenlosen Schrecken. Bodenlos? Vor Glück durfte ich reden, nicht noch tiefer gestürzt zu sein! Der Schacht setzte sich nach unten unendlich weit fort.
Ich bin keine Heldin. In meine Lage hatte mich mein Bestreben gebracht, als Hobbyarchäologin einen Erfolg vorzuweisen, ein einziges Mal nur in der Presse namentlich genannt zu werden. Immer war ich verlacht worden als die, die Sagen nachjagte und in Märchen abtauchte. Zwar berichteten jene von Schätzen, die hier draußen vergraben sein sollten, aber darauf gab ich nichts. Mir hatte es einfach das Erdloch angetan, das ich erforschen und über das ich berichten wollte.
»Licht!« Schrie ich. Immer wieder. Bis mir einfiel, dass ich allein war.
Der natürliche Schlot, in den ich gestiegen war, wies eine Engstelle auf. Als ich mich dort hindurchwand, zerbrach oben das Gestänge. Durch den Ruck hatte sich wohl meine Kletterleine losgerissen. Jedenfalls stürzte ich ab und sah den Karabinerhaken am Seilende mir nach fallen und, als ich auf dem Vorsprung aufprallte, an mir vorbeistürzen, soweit die Leine ihm erlaubte. Meine Lampe fiel hinterher. Die Rufe meiner Kameraden »Wir holen Hilfe!«, ermunterten mich nicht. »Warum wir? «, schrie es in mir, »sollte nicht einer an meinem Einstieg bleiben? «
Langsam wurde mir klar, dass ich auf mich selbst gestellt war. Ich lag auf dem Rücken, stemmte mich auf die Ellbogen. Ich wollte mich aufsetzen, doch stieß meine Stirn an die Decke meines Gefängnisses. »Die Leine«, fiel es mir ein, »die brauchst du noch.« Instinktiv drehte ich mich auf den Bauch und zog Hand über Hand das lose Seil ein und legte es in ordentlichen Schlingen ab. »Wozu ist es dir nütze?«, meldete sich mein Unterbewusstsein, »nach oben kannst es nicht werfen.« Da war sie wieder, die Angst! Zur Untätigkeit wollte sie mich verdammen, mir jeden Gedanken an Rettung nehmen.
»Und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal …« Gläubig war ich gewiss nicht, aber nun spendeten mir die spontan gemurmelten Worte Zuversicht. Ich konnte doch etwas tun! Langsam tastete ich meine Umgebung ab. Meine Füße offenbarten mir einen Tunnel, der von dem Vorsprung sich waagrecht in der Wand fortsetzte. Umdrehen konnte ich mich nicht, unweigerlich wäre ich von dem winzigen Sockel gestürzt. Rücklings zog ich mich mit den Fersen in die Röhre, stets bedacht, bei einem Hindernis nicht in Panik zu verfallen. Je weiter ich eindrang, desto dunkler wurde es. Nach mehreren Körperlängen fühlten meine Hände ein Ansteigen der Decke, irgendwann konnte ich mich aufrichten. Meine Erleichterung schwand schnell, als mir bewusst wurde, dass eine im Dunkel unsichtbare Spalte mich so umso leichter verschlingen konnte. Spontan ließ ich mich auf alle Viere fallen und betastete jede Handbreit, bevor ich mich vorwärts wagte. Meine Finger griffen etwas Rundes. Ich befühlte die Scheibe, führte sie an meine Zähne und erkannte sie an ihrer Festigkeit und dem flachen Relief, das ich ertastete, als Münze. Ein Schatz! Woran ich nicht geglaubt hatte, bot sich mir aus freien Stücken. Es musste der Schatz aus den Sagen sein, zumal ich weitere Münzen fand und etwas Geschmeide. Alles schob ich in meine Taschen. Euphorie trieb mich tiefer in die Finsternis.
So weit vom Schlot entfernt, umschloss mich vollkommene Schwärze. Ob es Einbildung war oder ob wirklich jemand im Flüsterton zu mir sprach, war mir unmöglich festzustellen. »Willkommen«, vermeinte ich zu hören, »seit Langem hat uns niemand besucht.« Sicherlich spielte mir meine Fantasie einen Streich. Oder führte ich ein Selbstgespräch mit verteilten Rollen? »Wo bin ich? Wer seid ihr?«, hörte ich mich fragen. Statt einer Antwort, glaubte ich eine Hand um meinen Arm zu spüren, die mich nach oben zog. Ich folgte und verspürte den unnachgiebigen Drang, weiter in die Höhle vorzustoßen, fort von dem letzten Bisschen Licht, das das Ende meiner Röhre als graue Scheibe erahnen ließ. Etwas zog mich, so wie jemand mit Höhenangst in den Abgrund starrt und sich hinabgezogen fühlt, beseelt von der Vorstellung springen zu müssen.
Weitere Stimmen drängten sich meiner Einbildung auf. »Komm weiter«, übersetzte mein Unterbewusstsein, »du bist in Sicherheit.« Echo erklang. Also war die Höhle weit, aber endlich. Etwas trieb mich weiter. Das Echo verstummte. Ich befand mich in einem Gang, konnte mit ausgestreckten Armen beide Wände berühren. Unter meinen Sohlen knirschte es und ich glaubte, darunter eine Wehklage gehört zu haben. Ich ging in die Hocke, meine Hand fuhr über den Boden. Panisch zog ich sie zurück, ich hatte Knochen berührt. »Komm weiter«, verlangte der Führer meines Unterbewusstseins, »pass auf deinen Weg auf! Die Vergangenheit fühlt Schmerz, wenn du ihre Reste zertrittst.«

»Wohin führst du mich?"
»Zu einer Erkenntnis, die sich euch Lebenden selten offenbart. Ihr kümmert euch nur um euer Jetzt oder sorgt euch um eure Zukunft. Ihr vernachlässigt eure Seele und vergesst. Hier erlangst du die Erinnerung wieder.«
Ungezählten Windungen folgte ich dem Gang und meinem Gefühl. Die Angst fiel von mir ab, Beruhigung und Neugier erfüllten mich, dazu ein nie so intensiv gespürter innerer Frieden. Kindheitserinnerungen stiegen auf, mein Toben auf der Wiese nahm ich ebenso mit den Augen wahr, wie ich den frischen Wind spürte, der mich mit dem Duft von Blumen und Wald umwehte. Meine Eltern, gestorben schon vor Jahren, saßen auf einer Picknickdecke. Ich war wieder das Mädchen, das unbeschwert das Leben genoss. Als ich den Blick hob, fand ich mich in einer riesigen Höhle. Ich folgte meinen Eltern bis in die Menge von Schemen, die sich als frühere Bekannte zu erkennen gaben. Über die Zeit hatte ich sie zum Teil schmerzlich aus den Augen verloren. Alles schien grau. Dennoch trübte die Eintönigkeit meine Freude keineswegs, sah ich doch eine bunte Welt, sobald ich die Augen schloss, und die Wiedersehensfreude überlagerte jedes Unbehagen.
»Bianca! Hörst du uns?« Dumpf klangen die Worte. Nach Ewigkeiten begriff ich ihre Bedeutung. Meine Kameraden waren zurückgekehrt, um mich hinaufzuholen. Aus der Dunkelheit zurück ins Licht!
»Kommst du wieder?«,
hörte ich meine Mutter fragen. Ich schluckte. Schon hatte ich mich umgedreht und hastete der Röhre entgegen, die mich zum Schlot geleitete.
»Ich bin noch hier! Es geht mir gut!«
»Wir lassen dir ein Sicherungsgeschirr herab und ziehen dich hoch. Beeil dich, die Schachtwand bröckelt schon! Lang hält sie nicht mehr, dann bricht der Schacht ein. Brauchst du noch etwas?«
»Mehr Licht!«, schrie ich, »nur mehr Licht!«
Schon hörte ich die Schnallen an den Wänden schaben, sah das Riemengeschirr. Dankbar lächelte ich. Dann fuhren meine Hände in meine Taschen, zogen Münzen und Schmuck hervor und ließen sie zusammen mit den von oben herabfallenden Steinen und Erdbrocken in den Abgrund rieseln. Ich band die Taschenlampe vom Seil und tastete mich in die Höhle zurück, in meine Vergangenheit.
ENDE
TRILOGIE: DIE CHRONIKEN DER WÄLDER

Diese E-Book-Trilogie "DAS ERWACHEN DER HÜTERIN" (Band 1), "DIE RÜCKKEHR DER ELYNN" (Band 2) sowie "DER TOD DER GÖTTER" (Band 3) bietet unseren Leserinnen und Lesern die Chance, eine sehr vielseitige Autorin kennenzulernen. Damit Sie mehr über sie erfahren können, besuchen Sie ihre Homepage:
https://www.esther-s-schmidt.de/
oder auch: https://www.facebook.com/Esther.S.Schmidt.Autorin
Esther S. Schmidt lebt in Frankfurt am Main. Seit 2005 ist sie in Zeitschriften und Anthologien vertreten und hat mit ihren Kurzgeschichten bereits mehrere Preise gewonnen. Mit ihren Romanen bewegt sie sich im Bereich der Phantastik. 2016 erschien ihr dystopischer Roman "DIE ZWEITE FINSTERNIS" bei Papierverzierer. 2020 folgte die Fantasy-Trilogie "DIE CHRONIKEN DER WÄLDER" bei dotbooks. Unter Pseudonym hat sie zudem einen Steam-Punk-Roman veröffentlicht.

In einer Welt, in der die Menschen Kriege um Macht und Einfluss führen, und die Elynn, die von den Göttern eingesetzten "Hüter der Wälder", kaum mehr als Legenden sind, müssen der Schwertsklave Daric und die Elynn Aroanida lernen, einander zu vertrauen. Schon bald empfinden sie mehr füreinander. Doch hat ihre Liebe die Kraft, auch ihre beiden Völker zu einen? Denn ein Feind erhebt sich, der nur gemeinsam besiegt werden kann.
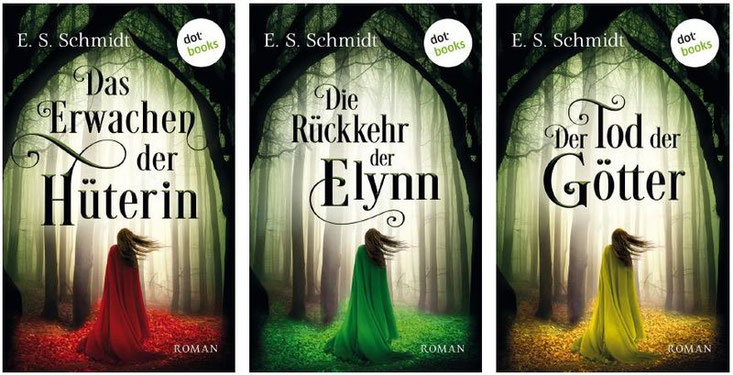
E-Books des dotbooks-Verlags überall erhältlich, wo E-Books angeboten werden
Sophie's ever young oldie
from the swinging twenties but eternally current?

sophie’s introduction
“Twenties Girl is a little different from my other books, as it’s the only one to feature a ghost! I wondered what readers would think of the idea and was thrilled to get so many amazing comments from readers who loved the main character, Lara, and the feisty flapper-girl-ghost, Sadie.
Lara’s great aunt Sadie comes back to haunt her as a flapper girl from the Twenties. Lara doesn’t even believe in ghosts, but here this girl is and she can’t escape her! Sadie has a mission for Lara and she just won’t stop pestering her about an old dragonfly necklace. It’s a story of an unlikely friendship, a story of fashion, love, dancing, and some cringingly embarrassing moments! I do hope you enjoy it…”

Sophie Kinsella hat viel zu bieten, schauen Sie rein und besuchen Sie Ihre Homepage!
https://www.sophiekinsella.co.uk/
Bei all den erfolgreichen Buchautoren, Filmemachern, Musikern, Künstlern und Unternehmern, sind viele junge Menschen geneigt, ihnen nachzueifern. Sie versuchen, es ihnen gleichzutun und beginnen, das Erschaffene dritter zu kopieren. Das ist der erste Fehlschritt eines Newcomers. Er lässt außer Acht, dass gerade die Erfolgreichen, mit eigener Kreativität zu Werke gingen und deswegen erfolgreich wurden. Deshalb unser Aufruf: Gehe Deinen eigenen Weg, verwirkliche Deine Ideen und erschaffe Deine eigenen Werke.
www.pierremontagnard.com
Jaume Borrell 11, 2/2
08350 Arenys de Mar, Catalunya, Barcelona, España
Tel: ++34 688 357 418 (WhatsApp)
E-Mail: info@pierremontagnard.com
