WIR STELLEN UNS VOR

In dieser Rubrik stellen sich junge und junggebliebene Menschen mit ihren Anekdoten vor, welche sie zu irgendeinem Zeitpunkt erlebt haben.
Zurzeit lesen Sie hier die folgenden Beiträge:
Carolina Pongratz Mein Erst-Werk
Isabelle Friedmann: Per Aufzug nach Afrika
Selina Kissmann: Im freien Fall
Anna Melina Albandopulos: Zur Langweile des Lockdowns
Lisa Zhang:
Endlich Ferien, keine Schulsorgen
mehr
Finn Lorenzen: Erinnerungen an den 17. März 2020
Pepe G.: Auf einem andern Planeten
Weya T.: Weyas Comedy-Shows
Maria Alejandra: Fische, Meer und Sprachensalat
Valerie Kyburz: Aufbruchstimmung! Zum Theater,
zum Film

Carolina Pongratz
Mein Erst-Werk
Die Geschichte meines Erstwerks führt uns vierzehn Jahre in die Vergangenheit zurück. Ich war fünf, ging in den Kindergarten und hatte noch nicht die Kunst des Schreibens und Lesens erlernt. Trotzdem verspürte ich auch damals schon das dringende Bedürfnis, Geschichten zu erzählen. Ich hatte eine ausgeprägte Fantasie und ein riesiges Vorstellungsvermögen, wie es Kinder so an sich haben.
Jeden Tag erschuf ich eigene Welten und Abenteuer, mit Freude, Verrat und Spannung. Meine Spielzeuge waren meine Werkzeuge, meine Puppen meine Schauspieler auf der kleinen Bühne meines Kinderzimmers. Ich war selbstredend der Regisseur und dirigierte meine Helden durch ihre Abenteuer. Die Weiten meines Spielens und die Möglichkeiten waren uneingeschränkt.
Es war auch rund um diese Zeit, als ich den Schock erlitt, dass meine kleine Schwester, die sonst ein hervorragender Statist gewesen war, Eigeninitiative ergriff und plötzlich selbst entscheiden wollte, was ihre Figuren taten. Ab sofort hatte ich es mit einem aufmüpfigen Star zu tun, aber auch das bekam ich unter Kontrolle.
Zur Entspannung von diesen Strapazen lasen mir meine Eltern jeden Abend Geschichten vor und öffneten mir damit die Türen zu komplett neuen Welten und Möglichkeiten. Eine neue Bühne für die Werke meiner Fantasie.
Ich sah kein Hindernis, das mir den Weg zu diesem neuen Medium versperren hätte können. Klar, da war das kleine Problem, dass ich nicht schreiben konnte, aber wie ein waschechter Künstler, ließ ich mich davon natürlich keineswegs aufhalten. Ich malte gerne und so setzte ich mich daran, die richtige Atmosphäre für meine Geschichte zu erschaffen. Mit Buntstiften erwachten die ersten Umrisse der Handlung zum Leben. Wie das Spielzeug beim Spielen, so platzierte ich meine Charaktere auf dem Papier. Damals waren Bilderbücher gerade der letzte Schrei und ich ging natürlich mit der Zeit.
Das liebevoll kolorierte Heftchen gab ich meiner Mutter, damit sie, die der Kunst des Schreibens mächtig war, den nächsten Arbeitsschritt übernehmen konnte. Unter meiner Ansage füllten sich die Seiten mit den genialen Worten meines fünfjährigen Ichs und die Geschichte mit dem klangvollen Titel „Rehlein findet einen neuen Freund“ entstand.
Ich erinnere mich bis heute noch an die Aufregung die ich verspürt hatte, als ich rastlos auf der Couch herumgehüpft war und mein Meisterwerk diktiert hatte. Wie ein Kaiser oder Philosoph ließ ich meine Weisheiten und Gedanken einfangen und in Worte fassen. Das Adrenalin, das ein aufregendes Erst-Werk verursachen kann, regte mich zu Höchstleistungen an. Wie ein Kapitän auf einer wilden Fahrt behielt ich kühl den Überblick über meine Geschichte und führte Rehlein zu seinem wohlverdienten Happy End.
Auch heute noch könnte man vor der Genialität dieses Meisterwerkes erzittern. Jetzt muss ich meine Geschichten zwar selbst abtippen und ich hüpfe dabei auch nicht mehr auf einem Sofa herum, aber Freude bereitet es mir mindestens genauso wie damals. Ich folge den Träumen meines fünfjährigen Ichs und wandele die Geschichten meiner Fantasie in Worte um.
Mit lieben Grüßen
Carolina


Isabelle Friedmann
Per Aufzug nach Afrika
Freudig springt mein mittlerweile zehn Jahre jüngeres Ich im 3. Stock in den gläsernen Lift. Für den nächsten internen «Kino über Mittag»-Anlass soll ich im ganzen Gebäude Flyer aushängen, was eine willkommene Abwechslung zur Arbeit am Schreibtisch, an Informationsbroschüren und dem Webauftritt darstellt, die ich den Tag über sonst auf meiner To-Do-Liste habe. Vom Dritten fahre ich in den 4. Stock und dann in den 5., wo ich jeweils in den Aufenthalts-Areas und bei den Treppenaufgängen bzw. Aufzugeingängen meine Flyer an die dafür vorgesehenen Korkwände pinne.
Um den kurzen Ausflug durch die Stockwerke und Gänge noch etwas agiler und erfrischender zu gestalten, hopse ich nach dem Abgrasen der oberen drei Etagen die Treppen hinunter bis ins Parterre und gönne mir dann eine schnelle Rauchpause am Hintereingang des Gebäudes.
Dabei fühle ich mich mit der schillernden Einbildungskraft Karl Mays einen Moment lang wild und frei, wie der wind- und wettergegerbte, dreitagebärtige Marlboro-Man, einziger, eigenmächtiger Herr über die Geschehnisse in der Prärie, von Sonnen Auf- bis Untergang!
Bevor ich mich kurzum wieder aufmache, um noch die Lobby und die Stockwerke 1 & 2 zu beflyern und mich dann wieder brav in meine Box zwischen all den anderen Bürohengsten und Paragraphenreitern einzureihen.
Am Eingang zum Lift treffe ich auf einen gut gekleideten Herrn mittleren Alters. Höflich begrüßen wir uns und gentlemanlike gibt er mir mit einem Handzeichen den Vortritt zum Besteigen des Aufzugs.
Da ich dem Herrn nicht aufzwingen will, mich auf meine Tour durch die Etagen 1 & 2 begleiten zu müssen, überlasse ich ihm die Auswahl am Armaturenbrett.
Er zögert jedoch und fragt dann:
«Ähm, wo ist Afrika?»
Ich antworte augenblicklich und völlig unbefremdet:
«Im 5. Stock»,
worauf er sich bedankt und den entsprechenden Knopf drückt.
Klingt komisch – aber genau diese, für Außenstehende leicht irritierende, für Interne hingegen absolut sinnhafte, kurze Unterhaltung habe ich 2012 als Praktikantin im Aufzug des mehrstöckigen Hauptsitzes der Bundesverwaltung für internationale Entwicklung und Zusammenarbeit geführt.
Bis heute erzähle ich sie gerne als kleine, sprachwitzige Anekdote aus dieser spannenden, lehrreichen Zeit.
Herzliche Grüße
Isabelle


Selina Kissmann
Im freien Fall
Stellt euch vor, ihr befindet euch im freien Fall. Ihr schwebt durch die Luft, das Haar weht durch den Wind. In diesem Moment seid ihr nur bei euch selbst. Euer Kopf ist angenehm kühl, frei, hat endlich mal eine Pause von all den negativen Gedanken und den Sorgen. Es gibt nichts mehr zu tun. Nur fallen.
Klingt eigentlich ganz nett, oder? Ich habe mir als Kind das Fliegen immer sehr erholsam, gleichermaßen allerdings auch aufregend vorgestellt. Schwerelos sein, durch die Lüfte gleiten wie Captain Marvel, Superman oder Spiderman mit seinen Netzen. Musste doch cool sein, oder? Ganz leicht werden, frei atmen können.
So sagte ich schon ganz früh, dass einer meiner Lebensträume (Es gab insgesamt drei: Psychologie studieren, die Nordlichter sehen und eben dieser), einen Fallschirmsprung zu unternehmen. So hätte ich diesen atemberaubenden freien Fall erlebt, ohne gleich sterben zu müssen. Die Idee war nett, doch dachte ich daran, meine Lebensträume aufzuheben und mit Ende zwanzig oder in den Dreißigern die ersten Träume zu erfüllen. Meine Eltern hatten allerdings andere Pläne.
Zu meinem sechzehnten Geburtstag schenkten sie mir also einen Tandemsprung. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich meine Augen aufriss, als ich erkannte, worum es sich handelt. Nie hatte ich erwartet, dass sie meine Worte so ernst nehmen würden. Erst recht nicht, dass ich so früh etwas von meiner Liste streichen würde. Ich freute mich natürlich, doch die Freude war mit anderen, nervösen Gefühlen verbunden. War es nicht immer nur eine schöne Vorstellung gewesen? Wollte ich es denn wirklich? Nun, meine Eltern hatten bereits bezahlt, so musste ich es wohl tun. Ich musste aus einem Flugzeug springen!
Eineinhalb Jahre schob ich den Sprung vor mich her. Bei unserem ersten Versuch war ich furchtbar aufgeregt, doch das Wetter war so schlecht, dass wir es verschieben mussten. Bei unserem zweiten Versuch, war das Wetter erneut nicht ideal, doch entgegen meiner Erwartungen wurde ich in den Anzug gepackt und in die Maschine geschickt.
Es war ein winziges Flugzeug mit sehr vielen Personen darin. Vier oder fünf Springer mitsamt ihren Begleitern, wie ich einen hatte. Wir saßen auf dem Boden. Mein Begleiter filmte den ganzen Ausflug, bereits seitdem wir eingestiegen waren. Meine Miene verfinsterte sich allerdings mit jeder Sekunde. So hoch, so schnell und ich sollte wirklich hinausspringen? Das wirkte alles so surreal.
Ich war die letzte Springerin. Ich sah mit an, wie die anderen vor mir in Position gingen und mit einem Wimpernschlag plötzlich verschwanden. Einfach so. Als ich an der Reihe war, machte mein Herz einen Sprung. Ich hatte keinen Einfluss mehr. Ich konnte nicht mehr abbrechen. Es war soweit. Und zwack, war ich weg. Der freie Fall dauerte nur eine Minute, doch es fühlte sich an, als vergingen Jahre, bis sich endlich der Fallschirm öffnete und wir langsam gen Boden glitten, mit einer einmaligen Aussicht.
Wieder auf der Erde angekommen, fragte mich mein Begleiter, stets mit der kleinen Kamera auf mein Gesicht gerichtet, ob ich nochmal einen Sprung machen wollen würde und ich nickte ganz aufgeregt, immer noch sprachlos, von dem gerade Erlebten – glatte Lüge!
Meine Ohren schmerzten von dem massiven Druck ganz fürchterlich! Die Aussicht ließ sich wegen dieser Tortur kaum genießen, welche mir im Übrigen bis zum Abend erhalten blieb. Und meine Idee von der Freiheit der Gedanken, der Klarheit des Kopfes und des freien Atems? Von wegen! Ich dachte nur daran, wann endlich dieser blöde Fallschirm aufgehen würde und wie lange wir schon am Fallen waren und wie zum Teufel ich bei dieser Geschwindigkeit an Luft kommen sollte! Falls ihr je ein Video sieht, in welchem jemand bei einem Fallschirmsprung oder sonst einem längeren freien Fall lauthals schreit, glaubt diesem Video kein Stück. Man schnappt bloß so wenig Luft, dass man sich selbst damit gerade so versorgen kann. Zum Schreien bleibt nichts über und man denkt auch nicht daran, jetzt erstmal loszuschreien. Es hört einen ja ohnehin keiner und den Fall stoppen wird es auch nicht.
Andererseits war das Video wirklich ziemlich cool geworden und es macht Spaß, die Leute mit der Geschichte zu beeindrucken „Ich war schon einmal Fallschirm springen“. Wenn ich so darüber nachdenke
… vielleicht mache ich es doch nochmal. 😉
Mit lieben, Luft knappen Grüßen
Selina


Anekdote zur Langeweile des Lockdowns
Anfangs telefonierte ich noch mit Freunden, doch bald gab es nichts mehr zu erzählen. Was sollten wir denn berichten? Jeder Tag lief absolut gleich ab. Um Punkte acht Uhr morgens saßen wir gähnend vor dem Computer und hörten dem Lehrer zu, der ebenso wie auch die Schüler nur als schwarze Kachel auf dem Laptop zu sehen war.
Ich muss wohl zugeben, dass auch ich dabei nicht immer ganz aufmerksam war, sondern mich von jeder Kleinigkeit ablenken ließ, seien es Kritzeleien auf Blockblättern oder eine neue Nachricht auf meinem Handy.
Ich erinnerte mich daran, wie ich mir noch ein Jahr zuvor gewünscht hatte, mehr schulfreie Tage zu haben, aber jetzt im Homeschooling wünschte ich mir nichts mehr, als wieder meine Freunde zu sehen und mit ihnen zusammen Unterricht zu haben. Sogar die Lehrer fehlten mir irgendwie. Die ganze Klasse wirkte fremd und auf eine gewisse Weise sehr weit entfernt. Dies wiederum machte mich traurig. Oft fühlte ich mich einsam. Ich las Bücher, schaute Filme, probierte neue Hobbys aus, aber nach einer Zeit wurde alles langweilig.
Als dann im Januar der erste Schnee fiel, ging ich nach draußen, um eine Runde zu spazieren. Es war nur ein kurzer Spaziergang, nicht länger als eine halbe Stunde, aber dennoch wunderschön. Zwischen der dünnen Schneedecke lugten feine Grashalme heraus, der Himmel war klar und blau und die Sonne glitzerte auf der eisigen Straße.
Als ich wieder zu Hause angekommen war, war mein Kopf frei und ich konnte mich auf den Berg von Hausaufgaben setzen, der auf meinem Schreibtisch wartete. Die frische Luft tat so gut und daher beschloss ich nun jeden Tag einen Spaziergang zu unternehmen.
Einmal schneite es in dicken Flocken. Ich lief an einem Schlittenberg vorbei, von dem wenige Kleinkinder kreischend hinunterrutschten. Ich lächelte und dachte an die Zeit zurück, als ich noch klein gewesen war und dort mit Freunden gespielt hatte.
Meine Spaziergänge wurden mit jedem Tag ein bisschen länger. Ich suchte nach neuen Wegen und Orte in dem kleinen Dorf, in dem ich wohnte, die ich noch nicht kannte.
Im Januar war es oft so kalt, dass ich meinen dicken Wollschal bis hinauf zur Nase zog. Wenn ich dann ausatmete, beschlug meine Brille, sodass ich fast nichts mehr sah. Zudem schmerzten meine Finger jedes Mal, wenn ich wieder nach Hause kam vor Kälte, obwohl ich Handschuhe anzog und meine Hände die ganze Zeit über in den Jackentaschen versteckte. Aber das störte mich nicht und konnte mich nicht davon abhalten hinaus zu gehen.
Meistens nahm ich Kopfhörer mit und hörte Musik oder Hörbücher. Besonders schön war es, klassische Filmmusik während des Wanderns zu hören. In der einsamen Natur hatte man dann das Gefühl, dass man sich gerade selbst in einem Film befand.
Eines Tages ging ich über eine Wiese, auf der noch kurz zuvor, als es noch wärmer gewesen war, große Pfützen gewesen waren. Jetzt war dort eine Eisfläche, die schon fast die Größe eines kleinen Sees hatte. Vorsichtig setzte ich einen Fuß vor den anderen, um zu testen, ob die Pfütze auch wirklich zugefroren war und tatsächlich, ich konnte auf dem Eis hin und her schlittern. Fast eine ganze Stunde verbrachte ich auf der Eisbahn und rutschte wild umher bis es dann schließlich dunkel wurde und ich mich auf den Heimweg machte.
Bald wurde es wieder wärmer und der Schnee schmolz. Ich freute mich schon auf den Frühling, denn die Natur sah so schneebedeckt zwar schön aus, aber doch immer gleich.
Die Sonne ließ die Grashalme wieder zwischen dem Eis hervorschauen und die Feldwege wurden feucht und matschig. Mit Gummistiefeln wanderte ich die Wege entlang und sank so manches Mal im Schlamm ein. Die Luft war immer noch kühl, aber nicht mehr so eisig, sondern angenehm und frisch.
Eines Tages sah ich einen Biber. Vielleicht war es auch eine Bisamratte, jedenfalls huschte das Tier direkt vor mir ins Wasser des kleinen Baches und war verschwunden, bevor ich überhaupt richtig realisiert hatte, dass dort ein pelziges Tier gerannt ist. Insgesamt sah ich während der Spaziergänge drei dieser Biber, aber auch sehr viele andere Tiere. Ich war so froh, auf dem Land zu leben, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich in der Stadt so einer Vielzahl von Tieren begegnen konnte. Hasen und Rehe, verschiedenste Vögel – darunter ein Eisvogel – und allerlei Fische in dem Bach, der quer durch das Dorf floss. Ganz besonders lustig war der Fisch, der fast so groß war wie mein ganzer Arm und der sich jeden Tag an der gleichen Stelle befand.
Ich ging wirklich jeden Tag spazieren, egal bei welchem Wetter. Einmal schien die Sonne, sodass ich sogar Anfang März im T-Shirt nach draußen gehen konnte, ein andermal regnete es so heftig, dass mir die kalten Regentropfen ins Gesicht peitschten und meine Regenjacke völlig durchnässte.
Seit ich überhaupt denken kann, habe ich Angst vor Hunden. Jedoch begegnete ich während der täglichen Spaziergänge sehr häufig Hunden, die aber meistens an der Leine waren, sodass ich keine Angst zu haben brauchte. Doch eines Tages – es war ein sonniger Samstagmorgen – sah ich schon in der Ferne einen Hund auf dem Feldweg wild umher rennen, sein Herrchen weit hinter ihm. Kurzum beschloss ich die geplante Route nicht zu laufen, sondern dem Hund aus dem Weg zu gehen. Letztendlich dauerte der Umweg viel länger und ich kam erst gegen Mittag wieder nach Hause, dafür hatte ich dadurch einen neuen Weg, entlang eines einsamen Feldes entdeckt.
Abends war es am schönsten, spazieren zu gehen. Die Sonnen-untergänge sahen jeden Tag anders aus. Einmal verschwanden die Strahlen in leuchtendem Gelb, das schon fast golden wirkte. Manchmal hatte der Himmel aber auch die Farbe von feuriger Glut und die eigentlich weißen Wolken färbten sich rosa.
Als sich der März dem Ende zuneigte, kam eine Nachricht, dass die Schule wieder anfangen würde. Natürlich freute ich mich, meine Freunde und Klassenkameraden wiederzusehen, aber irgendwie war ich auch traurig. Jetzt würde der Schulstress wieder anfangen. Hausaufgaben und Lernen für Abfragen und Klausuren würde meinen ganzen Tag in Anspruch nehmen und mir keine Zeit mehr für die Spaziergänge in der Natur lassen. Eines hatte ich in der ganzen Zeit zu Hause gelernt: Dass nichts schöner, entspannender und faszinierender ist als nach draußen zu gehen und sich ganz auf die Landschaft und alles, was dazu gehört zu konzentrieren. Auch heute, nachdem ich wieder regelmäßig Schule habe, versuche ich mir hin und wieder Zeit für einen Spaziergang zu nehmen, denn diese Wanderungen schafften es, die einsame Zeit des Lockdowns spannend zu gestalten.
Bleibt alle recht gesund und erinnert euch an alles Schöne!
Melina

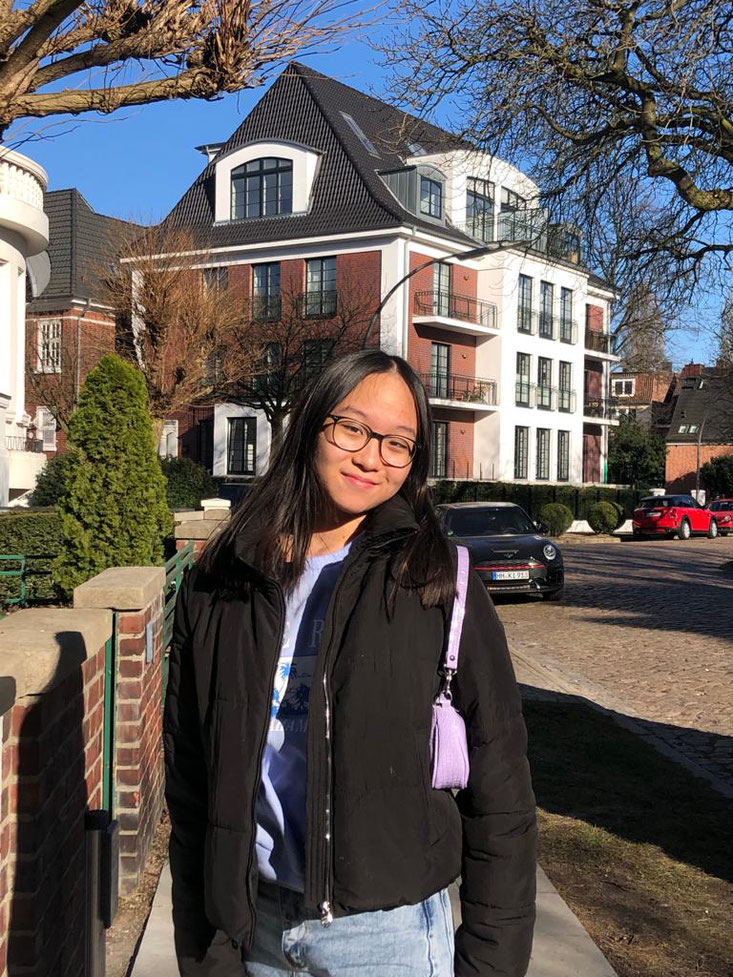
Lisa Zhang, Endlich Ferien, keine Schulsorgen mehr
Anekdote
Eine Anekdote … über mich? Ich? Das Mädchen, das sich selbst überhaupt noch finden muss? Mal sehen. Schwierig zu sagen, ob mein vierzehnjähriges Leben bisher lang genug war, um eine passende, mich ein wenig beschreibende Geschichte zu finden, oder eher zu kurz. Vielleicht sollte ich einfach nur einmal meine Augen schließen und die vorbeifliegenden Erinnerungen mit beiden Händen schnell festhalten … Da!
Es ist der letzte Schultag! Die letzten Wochen, Monate waren echt stressig. Ich interessiere mich für so viel! Zu viel?
Ich spielte Tischtennis. Zweimal die Woche. Im Privatunterricht und im Verein mit Punktspiel. Der Verein war ziemlich weit weg, doch er bot sehr gutes Training an, mein Trainer sah in mir sogar eine zukünftig professionelle Spielerin. Doch dann sollte ich bitte noch mehr trainieren kommen, am besten zweimal in der Woche zum Verein. Ich wollte so gerne zusagen, diesen wunderbaren Sport mehr auszuführen, dieses rasante Spiel, das manchmal so richtige Adrenalinschübe verursacht und diesen klaren Kopf, der blitzschnell reagieren muss, noch mehr fühlen… Aber ich interessierte mich auch so sehr für Musik!
Ich spielte Geige, leidenschaftlich, bei einem sehr guten Lehrer in Kaltenkirchen, zwei Stunden entfernt von meiner Heimat Hamburg, jede Woche Unterricht, jeden Tag üben. Aufgrund des Zeitdrucks war ich gezwungen, Mittagessen und Hausaufgaben während der Bahnfahrt zu verrichten. Doch der Zauber der wunderbaren, manchmal so zarten und manchmal doch so stürmischen Klänge zogen mich dorthin. Der Lehrer war streng, doch es lohnte sich. Mit meinen blutigen Fingern konnte ich tageweise nicht mehr spielen, doch eine Woche danach wieder mit neu gestärkten schönere Musik erzaubern.
„Lisa … Wenn du dich anstrengst, könntest du vielleicht mal darüber nachdenken, das alles hier zu studieren. Na, wie fändest du das?“
Aber … so ähnlich erging es mir doch auch mit Schauspielen, Programmierung, Sprachen, (damals 5), Kunst, dem Schreiben! In einem zarten Alter von elf Jahren. Nicht zu vergessen meine Freunde, die ich nicht vernachlässigen wollte, doch die sich sicher so fühlten. Trotzdem verstanden sie mich, oder sie versuchten es zumindest.
Doch an diesem Tag ist also erst einmal alles vorbei. Es ist sonnig, ich höre die Vögel zwitschern durch die geöffneten Fenster. Ein gekühlter Windhauch streicht um meine Schultern, warmer Blütenduft kitzelt meine Nase. Sommer. Sommerferien!
„Sooo!“, ruft die übermotivierte, wahrscheinlich genauso wie wir Siebtklässler, urlaubsreife Klassenlehrerin. „Ich wünsche euch wunderschöne Sommerferien, vergesst nicht, die Stühle hochzustellen!“
Sofort findet eine große Flucht ins Freie statt. Ein schnelles „Tschüss!“ an die besten Freunde, Umarmungen. Ich hetze mit einer Freundin die Treppen runter, wir rennen beinahe raus, an die frische Luft, auf die Straße und atmen keuchend und tief das Sommergefühl ein.
„Wie wohl die Lateinarbeit wird?“, jammere ich. Wir haben sie zuletzt geschrieben doch noch nicht wiederbekommen, was ich jedoch erhofft hatte. Ich hatte mir so viel Mühe gegeben. „Was wohl …“
„Hey.“, ruft meine Freundin. Wir bleiben stehen.
„Wir haben Ferien!, Auszeit, Pause! Tu comprends?“
Plötzlich müssen wir über meine unnötig gemachten Sorgen lachen. Sie hat recht! Sie hat sowas von recht! Manchmal braucht man eine Pause. Und dann sollte man diese Pause auch als solche anerkennen und genießen.
Soll doch unsere Lateinarbeit mal kurz den Mars besuchen ….., und vielleicht …., gleich dableiben?!
Herzliche Grüße take a break!
Lisa Zhang


Finn Lorenzen erinnert sich an den Tag, als alles anders wurde
Es ist Dienstag, den 17. März 2020
Der Morgen ist schön. Die kühle Luft streichelt mein Gesicht. Ich höre den Singvögeln und Krähen zu und habe Zeit. Alle Passanten schweigen finster. Nur eine Joggerin nicht. Sie kommt mir entgegen, ihr graues Haar wippt im Takt ihrer Schritte. Als sich unsere Blicke treffen, lächelt sie. Ich hätte weinen mögen.
Die Stadt pulsiert unter vorgehaltener Hand. In der Morgensonne liegt die Ruhe und doch suchen die Autos hektisch nach ihrem Ziel. Ich gehe die Straße hinunter und summe ein Lied vor mich hin. Es geht mir gut.
Hinter den Schaufensterscheiben sitzen kleine Gruppen und beraten sich. Ihre Gesichter sind ernst, sie müssen eine Entscheidung treffen, auch im Bettenfachgeschäft, wo sie auf Matratzen platz genommen haben. An der Ecke treffe ich einen Radfahrer. Er hat diverse Pakete Toilettenpapier geladen und bejubelt verhalten seinen Triumph. Ich gehe weiter.
Bei Aldi herrscht Chaos. Sechs Kassen sind geöffnet, der Laden ist voll. Die Leute kaufen reichlich, aber nicht viel. Pasta, Reis und Mehl sind trotzdem vergriffen. Ich hätte welches gebraucht. Verloren, wie weißes Gold. Viele Kinder sind dort. Sie lernen heute vom richtigen Leben anstatt aus Büchern. Neben mir erbeutet ein Vater einen riesigen Kohlrabi. Sein Sohn staunt und beide lachen. Ich freue mich für die beiden.
Das Lied, das ich summe, ist the Sound of Silence von Simon und Garfunkel. Hello Darkness my old friend. Der Laden füllt sich immer weiter. Dadurch, dass die Leute nicht mehr zur Arbeit können, werden sie hauptberufliche Einkäufer. Die Kassierer haben viel zu tun. Nicht mit mir. Ein Sack Möhren, zwei Gläser Brühe, ein Liter Milch. Es dauert nicht lange und ich bin wieder draußen. Es ist nicht dunkel, Herr Garfunkel, sondern morgenfrisch und frühlingshell. Ich gehe nach Hause. Die Welt ist schön.
Sie soll es bleiben!
Herzlichst Finn Lorenzen


Pepe G. studiert Tourismus mit Fokus Reisebegleiter in Barcelona.
Sein Austauschjahr in Japan hatte es in sich, doch lesen Sie selbst.
Auf einem andern Planeten
“No se me ocurre ningún título para esto jajaja!”
Am 12. Dezember 2020 kam ich von meinem Austausch-jahr in Japan zurück nach Barcelona. Da erhielt ich auf Insta-gram eine unerwartete Nachricht von einer verlorenen Freundin und es fühlte sich an, als hätten wir uns nie aus den Augen verloren. Sofort erzählte ich ihr von meinen täglichen Abenteuern in Japan und ein Ereignis war für sie ein Highlight. Sie sagte mir wie aus dem Nichts geschossen:
»Diese Geschichte ist sowas von reif für Pierre Montagnard.« Was sie damit meinte, wusste ich zuerst nicht, bis sie mir die Seite gezeigt hat und ich mehr als motiviert war, dieses Erlebnis mit euch allen zu teilen. In Japan waren gerade die Frühlingsferien und einige Freunde und ich wollten einen Ausflug machen, also entschieden wir, von Okayama nach Fukuoka zu gehen. Wir gingen in ein Tourismus Büro und buchten einen Trip nach Fukuoka und zwei weitere Orte.
In Fukuoka angekommen, machten wir uns auf den Weg zum Hotel. Dort sahen wir auf einer Karte, dass die Fahrt mit der Fähre nach Genkai Island nur etwa eineinhalb Stunden dauern wird. Einmal angekommen, wurde uns erst bewusst, wie groß diese Insel eigentlich ist und unsere Unterkunft war auf der anderen Seite derselbigen.
Wir beide hatten keinen gültigen Führerschein für Asien und da es keine touristische Insel war, gab es nicht viele Mitfahrgelegenheiten, also haben wir Fahrräder gemietet und sind mit denen zur Unterkunft gefahren. Da wir nicht auf der Straße fahren durften, mussten wir einen Weg durch den Wald nehmen und somit haben wir uns mindestens viermal verfahren. Erst nach 5 Stunden kamen wir endlich an unserem Ziel an. Wenigstens hatten wir echt schöne Aussicht auf das Meer, zumindest solange, wie noch Tageslicht vorherrschte.
Irgendwann wurde es dann aber dunkler und die Lichter unserer Fahrräder haben den Geist aufgegeben, also mussten wir die Taschenlampen von unseren Handys benutzen, um den Weg zu sehen und niemanden zu überfahren. Am späten Abend haben wir es dann auch endlich geschafft, das Gästehaus zu erreichen. Und da beginnt eigentlich auch schon die ganze Geschichte. An diesem Abend war da noch eine etwas ältere Dame so um die 70 oder 80, die bereits etwas zu viel getrunken hatte. Sie kam mir von Anfang an etwas komisch vor, aber ich dachte mir nichts dabei, da ich das Ganze auf den Alkohol geschoben hatte.
Plötzlich aus dem Nichts fragte sie mich, ob ich schwul wäre, da ich meinem Kumpel so herzliche Blicke zuwerfe, darauf antwortete ich mit Nein. Irgendwas schien sie zu stören und dann meinte sie, ich solle ihn küssen. Wir weigerten uns und sie wurde wie von einem Dämon besessen und fing an sich selbst zu schlagen. Uns wurde es zu viel und wir machten einen Rückzieher ins Zimmer.
Als wir nichts mehr hörten, machte sich mein Kumpel auf den Weg ins Badezimmer, um sich die Zähne zu putzen, auf einmal höre ich ein Geräusch, das vom Fenster her kommt, ich drehe mich also um, und sehe die Dame, die mich diabolisch anlacht.
Ich wollte die Türe abschließen aber ich wollte meinen Freund nicht verkaufen. Also lief ich zu ihm ins Bad und erklärte ihm das Geschehene. Als wir auf dem Weg ins Zimmer waren, stand sie da und wartete auf uns. Also liefen wir los, so schnell wir konnten und sie lief uns hinterher quer durchs ganze Haus. Nebst dem Herzrasen, da es etwas gruselig war, konnten wir uns fast nicht mehr vom Lachen erholen.
Zum Glück war sie nur halb so schnell wie wir und wir konnten ab und zu Verschnaufpausen einlegen, um uns wieder vom Lachen erholen zu können. Schließlich gelangten wir wieder ins Zimmer und schlossen mit dem Schlüssel ab. Wir hörten das klopfen und ihr verstörtes Lachen, aber wir hatten mehr Spaß als Angst, wir wussten, dass sie uns nichts antun würde, vielleicht steht ja die einsame, alte, alkoholisierte Dame einfach auf Gaylove!
Heute höre ich Ihr klopfen immer noch und kann über dieses Ereignis nur Lachen. Eine Pointe zu dieser Geschichte fällt mir nicht ein, da wir nicht wirklich eine Lektion gelernt haben, aber ich kann mit Sicherheit behaupten, dass ich in meinen 21 Jahren keine solchen Erlebnisse mehr hatte wie auf Genkai Island in Japan!
Saludos cordiales Pepe


Weya T. erinnert sich an ihre Comedy-Shows
Anekdoten und ich sind keine Freunde. Bei jedem treffenden Satz formt sich ein abweichender Gedanke, eine andere Erinnerung, eine neue Geschichte. Eine witzige Geschichte kurz und knapp zu erzählen, wie es eine Anekdote eben fordert, fällt mir daher nicht leicht. Wenn es aber eine gibt, bei der ich es versuchen möchte, dann ist es diese:
Als ich fünf Jahre alt war, lebte ich für ein halbes Jahr bei meiner Oma in Russland. Im Kindergarten hatte ich zuvor nur Deutsch gesprochen, sodass ich, trotz russischer Eltern, als Deutsche ankam und auch so wahrgenommen wurde. Die sprachliche Barriere löste sich jedoch nach wenigen Wochen in Luft auf und ich begann, nur noch Russisch zu sprechen.
Schnell sprach ich in meinen Träumen Russisch und formte sogar meine Gedanken im Kopf nicht mehr auf Deutsch. Ich klaute mir erwachsene und schlagfertige Formulierungen aus Talkshows, Komödien
und Werbungen, damit ich die Freunde meiner Oma beeindrucken konnte. An einem Grillabend im Wald mussten sich alle Anwesenden hinsetzen und mir bei meiner exklusiven Comedy-Show zuschauen. Bis
heute habe ich das strahlende Publikum bildlich vor mir, lachend und sichtlich verwirrt darüber, dass diese „Nemetskaya“ (=Deutsche) die Gags russischer Comedians draufhat.
Und obwohl mir der Sprachwechsel gefiel, fühlte ich mich verloren, als ich am Strand von Sotschi einen deutschen Jungen kennenlernte, dessen Sprache mir fremd
klang. Er fragte mich, wie die russische Übersetzung von der Märchenfigur „Hexe“ lautete und ich schaute ihn mit großen Augen an. Hexe? Was war das für ein komisches Wort? Es kam mir bekannt vor,
aber ich wusste nicht, was es bedeutete. Als meine Oma mir erklärte, dass „Hexe“ das deutsche Wort für „Vedma“ sei, erlosch mein Fragezeichen. Ich erinnerte mich. Natürlich; HEXE! Wie konnte ich
das vergessen?
Auch meine Mama staunte nicht schlecht, als ich, nun sechs Jahre alt, zurück nach Deutschland kam und keine richtigen Sätze mehr auf Deutsch bilden konnte. Und das drei Monate vor der Einschulung. Ich vermisste die Menschen, das Umfeld, meine Oma, meinen strengen Opa, die schäbigen Spielplätze, das leckere Essen, die Grillabende, die lauten, schrillen Stimmen russischer Menschen und ihre grobe, direkte Art.
Ich war ein sechsjähriges Mädchen, aber ich verstand bereits das Gefühl; das Gefühl von Fern- oder eben Heimweh.
Wenn ich heute fremden Menschen zuhöre, die Russisch sprechen, in der Bahn oder im Supermarkt, spüre ich immer noch dieses Gefühl. Obwohl mein Wortschatz kleiner wird und ich längst nicht mehr
Russisch spreche, in meinen Träumen ist es da. Ich kenne keine Zeit, die ich intensiver und schöner in Erinnerung habe als die sechs Monate im Heimatland meiner Eltern. Und das habe ich vor allem
meiner Oma zu verdanken, die ihren Freunden in schriller und ernster Stimme zurief: „Hey, alle hinsetzen! Weya macht eine Comedy-Show!“
Bleibt gesund und erinnert euch!
Herzlich
Weya


Maria Alejandra erinnert sich
Wir haben in unserer Kindheit und Jugend gezeichnet, gemalt, gebastelt, musiziert, getanzt, kleine Theaterstücke aufgeführt, Kurzgeschichten geschrieben und Sprachen gelernt. Wir sind teilweise in verschiedenen Kontinenten geboren. Dadurch haben wir viele Bekanntschaften, ja sogar schöne Freundschaften geschlossen. Das kreative Schaffen hat mitgeholfen, Selbständigkeit zu erlangen. Auch heute noch, im erwachsenen Alter, wo wir verschiedene Berufe ausüben, investieren wir weiterhin viel Zeit für kreatives Denken und Arbeiten. Wir haben die Idee, junge Menschen aus der ganzen Welt zu ermuntern, es uns gleichzutun. Viele Schüler haben verborgene Talente, welche oft von niemandem erkannt, oder entdeckt werden. In vielen Fällen werden sie sogar verkannt oder einfach ignoriert.
Ich bin in Bolivien aufgewachsen, meine Muttersprache ist Spanisch. Mit sieben Jahre zog ich mit meiner Familie in die Schweiz, wo ich dann Schweizerdeutsch und Schriftdeutsch lernte. Nebenher noch Englisch. Ich studierte zunächst zwei Jahre Hotellerie mit Schwergewicht Tourismus in Barcelona. Jetzt stecke ich im dritten Jahr für Wirtschaft mit Schwergewicht digitales Marketing. Da kam noch Katalanisch hinzu. Mein Vater sagte mir, als ich noch in Bolivien im ersten Schuljahr steckte; ›vergiss altertümliche Fächer wie Geschichte und Religion, lerne Sprachen, das bringt dich weiter.‹
Heute, mit über 20 Jahren, denke ich oft daran zurück. Er hatte mehr als recht damit. Das lustigste und unvergesslichste Erlebnis für mich war, (wir lachen noch heute darüber), als ich gerade mal zwei Monate in der Schweiz zur Schule ging, lud ich meinen Vater ein, zum Mai singen in die Schule zu kommen. Er kam und die Klasse sang Deutsch, Schweizerdeutsch, Rätoromanisch, Italienisch, Französisch, Englisch und Latein. Ich sang fröhlich mit. Mein Vater weinte fast vor lauter Freude. Auf dem Nachhauseweg fragte ich ihn dann: ›Hat es dir gefallen?‹ und er meinte voller Bewunderung; ›das ist ja völlig irre, wie hast du bloß so schnell und so viel gelernt?‹, und ich fragte; ›kannst du mir noch sagen, was das alles bedeutet, was wir da gesungen haben?‹
Es ist herrlich, an einem Tisch zu sitzen, wo Freunde aus aller Welt beisammen sind und ich mich in verschiedenen Sprachen unterhalten kann. Und es gibt auch immer viel zu lachen, wenn jemand eine Sprache lernt und ihm die üblichen Fehler des Anfängers unterlaufen. So fragte beispielsweise eine Freundin die andere; ›ya tienes la reserva del vuelo?‹ (hast du die Reservation des Fluges schon?) und die Freundin; ›no, estoy en la lista de esperanza.‹ (nein, ich bin auf der Hoffnungsliste!) richtig wäre, la lista de espera. (die Warteliste) und so weiter, bis sich Bauchschmerz anmeldet.
Und echter Bauchschmerz stellte sich vor zwei Jahren ein, als wir an der Küste Kataloniens in einem typischen Strandrestaurant dinierten. Bei blauem Himmel, Sonnenschein, leicht welligem Meer, saßen wir bei Paella und Sangría, als plötzlich ein rustikaler Fischer mit einem Eimer durch das offene Restaurant pilgerte. Er bot Fisch an. Da er wusste, dass in diesem Restaurant nicht nur Einheimische dinieren, sondern auch Auswärtige und Touristen, sprach er Katalanisch, Spanisch und Englisch. Er ging von Tisch zu Tisch und da und dort wurden ihm einige Fische abgekauft. Ines, meine beste Freundin, die etwas Englisch, auch etwas Spanisch spricht, war neugierig und wollte einen Blick in den Eimer werfen. Mit einer Geste winkte sie den Fischer heran. Er kam und Ines guckte in den Eimer. Sie erwartete darin einen oder mehrere größere Fische, doch es waren nur klitzekleine darin, Sie schaute den Fischer überrascht an und sagte mit vehementer Stimme; ›hey man, a little pequeño su fish!‹ Selbst der Fischer setzte sich einen Moment hin und lachte.
Mit lieben Grüßen
Alejandra


Valerie Kyburz
(ihr Pseudonym), hat uns freund-licherweise einige ihrer besten Aufsätze aus ihrer Schulzeit zur Veröffentlichung zugestellt. Sie ist heute 29 Jahre jung, war das enfant terrible ihrer Schulzeit, setzte entgegen ihrer Eltern ihren Willen durch und besuchte das Kindertheater von Basel. Heute ist sie ausgebildete Theater- und Filmschauspielerin, inszeniert eigene Theater-Stücke und produziert eigene Video-Kurz-Krimis. Ihre sehr originel-len Aufsätze haben uns in den letzten Monaten im Newsletter unterhalten. Sie finden diese auch in der Rubrik der Fortset-zungsromane.
Aufbruchsstimmung: Zum Theater! Zum Film!
Schon oftmals habe ich mich versucht zu erinnern, welches nun wirklich der entscheidende Funke war, der mich zum Theater brachte. Der Schritt zum Film ist dann wohl eher eine Folge davon.
Vielleicht waren es auch mehrere Funken. Was mich ganz bestimmt in Bann zog, waren die Gerüche. Das Theater verbreitet Gerüche. Polster, Kleider, Perücken, Kulissen, der große Vorhang mit seinen noch größeren Geheimnissen. Zumindest so lange, bis er aufgeht. Und wenn er aufgegangen ist, sind es die Kulissen, die sehr unterschiedliche Gefühle in mir weckten. Bäume und Wald vermittelten in mir Spannung, auch ein bisschen Angst, Ungewissheit, vor allem dann, wenn noch keine Schauspieler da waren und nur die Kulissen auf mich einwirkten. Manchmal war ich auch enttäuscht, wenn nur eine spärliche Hausfassade da war, eine Türe die ins Haus führte, daneben ein kleiner runder Tisch mit zwei Stühlen so klein, als würden gleich Zwerge auftreten. Die Szene hell belichtet, die keine Hoffnung auf etwas Mysteriöses entfachen konnte. Doch dann faszinierte mich ein Troubadour, der plötzlich da war und mit lauter, deutlicher und sicherer Stimme sprach, die ganze Szene dominierte und die ärmliche Kulisse vergessen ließ.
In den ersten Schuljahren hatte ich nur drei Freundinnen, für die Theater auch ein Thema war, doch das Gros der Klasse sah sich allenfalls als möglicher Theaterbesucher, jedoch niemals als Darsteller.
Da ich bereits im Kindergarten Alter Ballettunterricht genoss, hatte ich einen Vorgeschmack darauf, dass bei einer entsprechenden Ausbildung auf der Bühne eine gewisse Härte an Disziplin verlangt würde. Davor hatte ich keinen Bammel, auch wusste ich ziemlich genau was ich nicht wollte. Keine Oper oder Operette, kein Musical und auch keine Auftritte in einem Kolosseum oder Amphibientheater. Ich wollte das, was mich auch als Zuschauerin faszinierte. Das hautnahe Bühnentheater, wo der Besucher jeden Fehltritt (Körper) oder Versprecher (Text), mitkriegt. Eine riesige Herausforderung. Nicht wie beim Film, wo bei jedem Fauxpas ein Cut erfolgt und die Szene so lange wiederholt wird, bis der Regisseur zufrieden ist. Aber an dem Tag, als ich es wusste, dass Theater meine Welt sein sollte, stand der höchste zu bezwingende Berg, meine Eltern, noch vor mir.
Dieser „Lokalkrieg“ dauerte fast ein Jahr und ich schien ihn zu verlieren, doch dann hatte ich die Eingebung. Meine Eltern argumentierten cool nicht etwa aggressiv, aber fast endgültig. Ich wiederum wollte nicht so kindisch reagieren wie einige aus meiner Klasse, wenn ich bei ihnen zu Hause ähnliche „wir erlauben dir das nicht“ Situationen erlebte und die Reaktionen der Kinder dann sehr schmollend und eben auch hoffnungslos endeten.
André Gut ist vier Jahre älter als ich, spielte bereits Theater. Ich lernte ihn auf einer Geburtstags-Party von Evelyn Hauser kennen. Er gefiel mir auf Anhieb, ich ihm vielleicht auch, jedenfalls war das gerade mitten im „Krieg“ mit meinen Eltern. In einem günstigen Moment machte ich mich an ihn ran und konnte ihn für ein Gespräch gewinnen. Ich schilderte ihm ohne Zuckerguss mein Problem, er hörte mir aufmerksam zu, dann fragte er mich, wann mein nächster Geburtstag wäre. Ich sagte ihm das lachend und fragte, was das mit meinem Problem zu tun hat und er sagte; „lade mich zu deinem Geburtstag ein, stelle mich deinen Eltern als deinen besten Freund vor und den Rest mache dann ich. Da dein 12. Geburtstag auf einen Samstag fällt, können wir dich am Montag darauf beim Basler Kindertheater einschreiben. Ein Familienmitglied muss dabei sein zum Unterschreiben.“
Einen Moment lang brachte ich meinen Mund nicht zu und er küsste mich ganz schnell, sagte noch; „ich dachte zuerst, du hättest ein ernst zu nehmendes Problem, aber du hast keines, deine Eltern haben eines! Ich werde es ihnen nehmen!“
Es braucht einiges, mich sprachlos zu machen, aber er schaffte es und er hatte sogar die Unverfrorenheit, mich bis zu meinem Geburtstag im Dunkeln tappen zu lassen, wie er meine Eltern „umdrehen“ würde.
Er tat es dann mit einer Leichtigkeit, wie ein Clown ein kleines Kind zum Lachen bringt. Zunächst hatte er dafür Sorge getragen, dass er ein positives Punkte-Kontingent auf seinem Konto, meine Eltern betreffend, eingeheimst hatte, dann stieß er gnadenlos zu. Die Torte war fast vertilgt, hebt er sein Kinder-Champagner Glas, prostet meinen Eltern höflich zu, bedankt sich für die herzliche Gastfreundschaft, dann zu mir mit den Worten; „liebe Valerie, nochmals herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag und besonders zu deinem schönen Geschenk von deinen Super Eltern, die dich Theater spielen lassen, mit eurem aller Einverständnis begleite ich euch am Montag zum Direktor für deine Registrierung und weißt du was Valerie, der neue Direktor hat mir die Hauptrolle im Stück ›Die Hexe aus dem Weltall‹ gegeben, er möchte, dass die Rosmarie Scholl meine Tochter spielt, aber ich möchte lieber dich, weil, weißt du was? Der Direktor sagte mir, wenn das Stück Erfolg hat, wird es verfilmt fürs Fernsehen, yupppiiieee, prost!“
Einen kurzen Moment blieb mir das Herz stehen, doch nur kurz, ich erkannte Andrés Schauspiel, sein gewaltiges Talent, Menschen zu fesseln, an der Nase herumzuführen oder falls nötig, sie für kurze Zeit als Tanzbären vorzuführen. Ich schlüpfte in seine Rolle, ließ, wie hergezaubert, ein paar Freudentränen über meine Wangen kullern, setzte das glücklichste Gesicht meines Lebens auf, hielt das Glas immer noch wie eine hypnotisierte mit angewinkeltem Arm, zum Anstoßen bereit in der rechten Hand und wandte dieses „Werbebild“ meinen Eltern zu.
Der Mund meiner Mutter war noch weiter offen als meiner zu Beginn dieser bühnenreifen Szene doch in ihren Augen las ich, dass gleich eine gehörige Opposition einfahren würde. Aber Vater verhinderte es. Er war in diesem Stück der Tanzbär, stieß zunächst mit mir, dann mit André an und sagte feierlich; „so viel Freude muss einfach gefeiert werden, ich wünsche euch viel Glück“, und zu Mutter gewandt; „ist noch eine Flasche da? Kinder Champagner hat mir noch nie so gut geschmeckt wie heute, du wirst die beiden am Montag begleiten und Valerie einschreiben!“ (nächste Szene; der Mund meiner Mutter bleibt weiter offen, doch die Augen verlieren den Oppositionsglanz).
* * * * *
Nachdem ich eingeschrieben war an besagtem Montag, lud uns Mutter noch zum Nachtessen ein, André und mich. Später gesellte sich sogar Vater noch dazu, der sich danach von mir und Mutter verabschiedete, weil er mit André noch etwas zu besprechen hätte.
Natürlich hatte ich etwas den Bammel, weil ich meinen Vater kannte und wusste, dass man ihn nicht so leicht aufs Glatteis führen konnte und ich glaubte zu diesem Zeitpunkt auch noch, dass André die Hexe aus dem Weltall, die Rosmarie Scholl, seine Hauptrolle, die Verfilmung, den neuen Direktor und mich als seine Tochter einfach so auf die Schnelle erfunden hatte, um eben glaubhaft zu wirken.
Keinen Bammel hatte ich jedoch vom Zugeständnis meiner Eltern, dass sie nun ihr „Geschenk“ an mich rückgängig machen würden. Vater würde sowas niemals tun. Erst am Mittwoch, als ich André wieder alleine treffen konnte, lüfteten sich noch ein paar Dinge, die mich sehr froh und glücklich stimmten und schließlich noch zu ein paar Lachsalven führten.
André schwindelte gar nichts. Es stimmte alles, was er an meinem Geburtstag erzählte. Alles.
Mein Vater nahm ihn ins Gebet und war, nachdem er gewusst hatte, dass nichts gelogen war, noch mehr von ihm angetan. Sein Schluss-Plädoyer ihm persönlich gegenüber lautete; „ich bin in meinem Geschäftsleben einigen Lausebengels begegnet, doch du bist der jüngste Satansbraten von allen. Viel Glück und Erfolg! Pass etwas auf mein Kind auf, solange es in deinem Blickfeld weilt.“
Auch dies tat André souverän. Er lehrte mich noch ein paar andere nützliche Dinge, zum Beispiel wie man mit Erwachsenen umgeht, denn darin ist er ein unbestrittenes Genie!

Bei all den erfolgreichen Buchautoren, Filmemachern, Musikern, Künstlern und Unternehmern, sind viele junge Menschen geneigt, ihnen nachzueifern. Sie versuchen, es ihnen gleichzutun und beginnen, das Erschaffene dritter zu kopieren. Das ist der erste Fehlschritt eines Newcomers. Er lässt außer Acht, dass gerade die Erfolgreichen, mit eigener Kreativität zu Werke gingen und deswegen erfolgreich wurden. Deshalb unser Aufruf: Gehe Deinen eigenen Weg, verwirkliche Deine Ideen und erschaffe Deine eigenen Werke.
www.pierremontagnard.com
Jaume Borrell 11, 2/2
08350 Arenys de Mar, Catalunya, Barcelona, España
Tel: ++34 688 357 418 (WhatsApp)
E-Mail: info@pierremontagnard.com
