SCHMUNZELECKE

Wir sollten auch über uns selber lachen können, nicht nur über andere
Christine Todsen
Im Zoo
(Urheberrechte & Copyright © by Christine Todsen)
Herr und Frau Meier standen im Zoo vor dem Affengehege und beobachteten ein Schimpansenpärchen, das auf dem Boden hockte.
„Hast du schon gehört“, fragte sie ihn, „dass wir uns nur zu 1,3 Prozent von denen da unterscheiden?“
„Gehört wohl, aber glauben tue ich das nicht. Allein schon im Aussehen ist der Unterschied doch viel größer. Und dann kommt noch alles andere hinzu.“
„Es geht nicht um Aussehen und so weiter, sondern um das Genom. Was das ist, weiß ich auch nicht. Aber die Wissenschaft hat herausgefunden, dass das Schimpansen-Genom zu 98,7 Prozent mit dem menschlichen Genom übereinstimmt.“
„Da kannst du mal sehen, was diese Wissenschaftler für einen Unsinn verzapfen“, lachte er.
Sie schwieg eine Weile. Dann fragte sie:
„Was meinst du: Wer ist glücklicher? Wir oder die?“
„Das kann man nicht so einfach sagen. Das hieße, Äpfel mit Birnen zu vergleichen.“
„Ich jedenfalls würde nie mit denen tauschen wollen“, sagte sie voller Überzeugung.
„Ich auch nicht. Obwohl – unglücklich sehen die beiden doch eigentlich nicht aus.“
„Nein“, antwortete sie, „aber sie kennen es eben nicht anders. Mich dagegen würde ihre Lebensweise verrückt machen. Allein schon das ständige An- und Ausziehen. Unser Fell ist doch viel praktischer. Laus mich!“
ENDE


Streifschuss vom 07. Juni 23
Anlass: das Landleben in der frischen Luft
Großmutters Erbmasse (von Bernhard Horwatitsch)
Die Natur wird als Leitkategorie aufgefasst und steht im Gegensatz zur Kultur. Wir sprechen oft von natürlichen Ressourcen, als wären Öl und Uran ganz unnatürliche Dinge. Wind und Sonne dagegen sind natürlich. Das Landleben erlebte zuletzt eine Renaissance. Die Schäfer-Idylle wurde von ausgebrannten Stadtmenschen schon immer idealisiert. Ein schönes Fundstück stammt von Sándor Rosenfeld, bekannt unter seinem Künstlernamen Roda Roda, der 1872 in Dirnowitz, mitten auf einem mährischen Acker zur Welt kam, Soldat wurde, sich selbst entließ und für den Simplicissimus satirische Texte schrieb. Weil er auch eine Satire über Hitler verfasste, floh er erst nach Graz, nach dem Anschluss Österreichs in die Schweiz, da warf man ihn auch raus, dann – schon in den 70ern – in die USA. Das war am Ende nur noch Flucht. Alles, was sein Tun und Schreiben ausmachte, war erloschen, als er 1945 in New York an Leukämie verstarb. Hier eine Erinnerung mit einem wunderbaren Reflex auf das Thema Landleben, das so viele derzeit in ihrer Natur-Verblendung feiern.
Roda Roda
In zahllosen Mitbürgern gärt und glimmt heimlich die Sehnsucht nach dem Lande. Man träumt von einem Häuschen im Grünen – einem Garten mit Blumen – Frieden – Abendläuten – Sonnenuntergang.
Nicht Rousseau hat an diese Rückkehr zur Natur erinnert: Es ist Großmutters Erbmasse, Atavismus des dritten, entwurzelten, in die Stadt verpflanzten Geschlechts.
Doch warum nicht gleich auf Bäume klettern? Wie der Ur-Papa?
Hört mich an: laßt diesen blödsinnigen Durst nach Landluft! Ich bin auf dem Lande aufgewachsen; mein Geburtsort hatte 49 Einwohner; 96 vom Hundert waren Analphabeten; zwei Prozent konnten lesen und schreiben: ich nämlich.
Da bin ich bis zu meinem zwanzigsten Jahr geblieben. Ich kenne das Landleben durch und durch.
Nieder mit Virgil, Georgica, Bucolica! Pfui Rousseau! Haller und Mörike an die Laterne! – Es muß endlich enthüllt sein-in Wahrheit verhält sich die Sache wie folgt:
Die Natur besteht aus Ameisen und Brennnesseln, das Dorf aus Fliegen, Bauern, Kälberdreck.
Das Land ist unbewohnbar. Die Hütten enthalten Wanzen. Die Mauern triefen. Die Türen klaffen. Die Öfen rauchen.
Der Zustand des W.C. allein schon schreit zum Himmel. Es steht weitab vom Haus, einsam auf der Flur, in das Türchen ist ein Herz geschnitten. Dünste zeigen das Wetter an; schlechtes Wetter. –
Ruhe auf dem Land? Haha: die Stiere brüllen, die Kühe muhen, Schafe blöken, Hähne krähen, Hühner gackern – jegliche Art Vieh macht sein Geräusch. – Und die Bauern? Ha! – Und die Balken? Krachen. – Das ist die Ruhe auf dem Land.
Man wähnt, es gebe selbst gezogenes Gemüse auf dem Land. Der Wahn trügt – es gibt kein Gemüse. Selbst gezogene Karotten erreichen im besten Fall Daumengröße; ich habe auch Westenknöpfe erlebt. – Ich habe, mit dem Schweiß des Fleißes auf der Stirn, Spargelbeete von Meilenlänge angelegt, zwölf nebeneinander, wie Eisenbahndämme. Ergebnis: Stricknadeln, nichts weiter. Einmal ernteten wir einen Bleistift; man mußte ihn vor dem Genuß mit dem Hammer schmieden. – Wirklichen Spargel gibt es nur in Büchsen.
Daß auf dem Lande Obst gedeiht, ist häretischer Aberglaube. Nein, Obst gedeiht nicht. Die Pflaumen sehen nur so aus ; sind aber sauer, hart, wurm zerfressen und mit Harztropfen behangen. – Die Äpfel sehen nicht einmal so aus ; Adam muß ein Rindvieh an Gefräßigkeit gewesen sein – falls er auf dem Lande aufwuchs …
Das Fleisch ist ungenießbar; es besteht aus Sehnen. – Den Hühnern ist das Federkleid unmittelbar an das Skelett gewachsen. Übrigens krepieren die Hühner vorzeitig an Pips; die Gänse werden von Hühnerläusen gefressen, die Enten von den Ratten ; nur die Ratten bleiben – Sieger im Daseinskampf.
Die Atmosphäre schneit und regnet. […] Mal zumal, in den Pausen zwischen zwei Katastrophen, prangt er richtig, der goldne Sonnenuntergang.
Dann breitet sich rosiger Kitsch über die Gefilde – eine kosmische Ansichtskarte. Zum Speien.
So viel über das Landleben.
ENDE
(Roda Roda : Roda Rodas Geschichten, Rowohlt, Reinbek, 1956, S. 59–60).

Streifschuss vom 26. April 23
Anlass: Wer in einem gewissen Alter nicht merkt, dass er hauptsächlich von Idioten umgeben ist, merkt es aus einem gewissen Grunde nicht.
Battle of Oldtimer
(von Bernhard Horwatitsch)
Ich kenne einen netten älteren Herrn, der sitzt meist in einem RCN Walker Gehwagen, da er recht unruhig ist und nicht mehr so gut alleine laufen kann. Auf diese Weise bleibt er mobil. Er redet manchmal verrücktes Zeug, das niemand so recht versteht, ist aber ein total freundlicher und zugewandter Mann, der positiv auf die Öffentlichkeit wirkt. Alle mögen ihn. Auch er würde sich zum Präsident eignen, keine Frage.
Wenn im nächsten November (im Jahr 2024) die 60. Wahl eines US-amerikanischen Präsidenten stattfinden wird, treten vermutlich zwei Abrahams an. Sollte vorher Russland nicht noch ihre taktischen Atomwaffen taktlos einsetzen – und die auf dem Straßenpflaster fest geklebte letzte Generation Z in den aufgewärmten Himmel schießen. Derzeit wird daher in den Nachrichten sehr viel über das Alter kommentiert. Biden und Trump sind ja etwa gleich alt. Würde das geplagte Volk der Vereinigten Staaten Trump wählen, wäre dieser nicht der älteste Präsident aller Zeiten, weil Biden immerhin gute zwei Jahre älter ist und Trump ihn nur einholen kann, wenn er verliert, noch mal 2028 antritt und dann gewinnt. Beide Kandidaten erinnern mich nicht im Entferntesten an den netten älteren Herrn in seinem RCN Walker Gehwagen, nein nicht im Geringsten. Joe Biden käme ihm noch am nächsten. Aber dessen Freundlichkeit könnte auch medial aufgesetzt sein. Den älteren, netten Herrn in seinem RCN Walker Gehwagen kenne ich schließlich persönlich und bin von seiner grundsätzlichen Aufrichtigkeit und Lauterkeit absolut überzeugt. Denn sein mentaler Zustand lässt ihm für die Täuschung kaum kognitiven Spielraum. Vielleicht wäre ein demenziell veränderter Präsident des mächtigsten Landes der Welt sogar ein Glücksfall, da diese Menschen eine Form des Hier und jetzt leben und sich so in einer Form von Aufrichtigkeit und geistiger Wahrheit präsentieren, dass ihre Handlungen nicht mehr infrage gestellt werden könnten. Aber Alter und Demenz sind keine selbstverständliche Kohärenz. Daher empfand ich die lästernden Kommentare in den Nachrichten über das Alter der Kandidaten unangenehm. Wir leben in einer überalterten Gesellschaft und Jugendlichkeit ist kein Garant für Intelligenz, Tatkraft und politischem Feingefühl. Die vielen jüngeren Optionen in den USA sind nicht umsonst übergangen worden. Es sind viele unsägliche Pfeifen darunter, wie der Hochstapler George Santos, der ein bisschen dem Abituranwärter Philipp Amthor ähnelt. Oder der Mafia-Boss Ron de Santis, dem Viktor Orban der USA. Oder der indische Tech-Unternehmer Vivek Ramaswamy, der Rassismus okay findet, wenn man nur ordentlich damit verdient. Nikki Haley, die aber nur im einprozentigen Bereich liegt und Trump kaum gefährlich werden kann, die wird untergehen, so wie sie immer wieder betont, dass das angeblich mit den USA droht, wenn die Konföderierten-Flagge nicht mehr wehen darf, wie sie will. Alle sind sie unter 50 Jahre alt. Gut. Besser? Nö. Gar nicht. Idioten gibt es in jeder Altersstufe, und nette Leute sind auch mal alt. Klar. Ich vermaledeiter Baby-Boomer verteidige mich hier doch nur selbst, oder? Sicher. Ich bin nun auch bald alt. Zu Trump und Biden fehlen mir allerdings noch gute 25 Berufsjahre. Was ich nicht verstehe, ist, warum man sich mit 83 Jahren noch so was antun will. Ich wollte schon jetzt niemals Präsident werden. Präsident sein ist doch furchtbar anstrengend, oder? Ist das wirklich Verantwortungsgefühl? Möglich kann das ja sein, und dann sind Trump und Biden keine alten Säcke, sondern Helden des modernen Politik-Trash. Superman ist schließlich auch schon 90 Jahre alt. Es war das Jahr 1933 als er zum ersten Mal in Ohio die Welt rettete, selbstverständlich mit Hilfe von Telepathie und Telekinese, die Kräfte, die ihm Jerry Siegel in seiner Kurzgeschichte The Reign of the Super-Man aus dem Jahr 1933 gab. Und mal ehrlich: Adolf Hitler war doch damals viel zu jung für diese heroische Aufgabe der Errichtung eines 1000-jährigen Reiches.
ENDE

Streifschuss von
Bernhard Horwatitsch
Anlass:
Dass der Hund mir lieber sei ….
Was vom Pferd erzählt
…, da las Ulrich irgendwo, wie eine vor verwehte Sommerreife, plötzlich die Worte »das geniale Rennpferd«.
… das Pferd ist seit je das heilige Tier der Kavallerie gewesen, und in seiner Kasernenjugend hatte Ulrich kaum von anderem sprechen hören als von Pferden und Weibern und war dem entflohen, um ein bedeutender Mensch zu werden, und als er sich nun nach wechselvollen Anstrengungen der Höhe seiner Bestrebungen vielleicht hätte nahe fühlen können, begrüßte ihn von dort das Pferd, das ihm zuvorgekommen war. (MoE Kapitel 13).
Der kluge Hans – das Pferd, das Ulrich zuvor gekommen war, war ein fünfjähriger schwarzer Orlow-Traber aus Russland, den der deutsche Elementarschullehrer Wilhelm von Osten im Jahr 1900 erwarb und zwei Jahre später über eine Anzeige im Militärwochenblatt verkaufen wollte, mit dem Hinweis, dass dieses Pferd zehn Farben unterscheiden könne und vier Grund-rechnungsarten beherrsche.
Niemand reagierte auf diese Anzeige. Der Lehrer, der seinem Pferd mit den gleichen Methoden wie seinen Schulknaben das Rechnen beigebracht hatte, gab aber keineswegs auf. Er schaltete eine weitere Anzeige, diesmal im deutschen Offiziersblatt und lud zu einer Besichtigung seines klugen Pferdes ein. Ein Generalmajor kam auch und war fasziniert, schrieb einen Artikel über den Lehrer und sein Pferd. Das löste eine Begeisterung in ganz Deutschland aus.
Plötzlich gab es im ganzen Land sprechende Hunde, Katzen, Bären. Der berühmte Großwildjäger, Fotograf und Tierschützer (irgendwie widersprüchlich, aber so steht es auf Wikipedia) Carl Georg Schillings führte der Allgemeinheit das geniale Pferd vor. Eine 13-köpfige Kommission unter der Leitung von Professor Stumpf (Musil hatte bei ihm studiert), prüfte das Pferd und kam zu dem Schluss, dass keine Tricks im Spiel waren. Es handelte sich tatsächlich um ein geniales Pferd. Nur ein kleiner Doktorand war skeptisch. Typisch! Diese Kleingeister, die keinen Sinn für Größe haben. Der Doktorand Herr Pfungst, testete und testete, er gab dem Tier auch Scheuklappen und stellte fest, dass das Tier mit Scheuklappen plötzlich nicht mehr rechnen konnte. Der kluge Hans hatte sich nämlich alle Ergebnisse nur abgeschaut aus den erwartungsvollen Gesichtern der Zuschauer. Die kannten das Ergebnis ja schon. Und wenn der kluge Hans mit seinen Hufen klopfte, schaute er in die Gesichter seiner Zuschauer und erkannte ihre Begeisterung, wenn er sich der Lösung näherte. In gewisser Weise ist dieses Tier doch genial. Nur auf eine andere Weise. Dr. Pfungst schrieb dazu auch ein Buch und das führte erst einmal dazu, dass man überhaupt nicht mehr über die Mensch-Tier-Kommunikation forschte, weil man nach dieser Peinlichkeit lieber die Finger davon ließ. Musil dichtete noch ein Epitaph auf Dr. Pfungst:
Hier ruht Oskar Pfungst,
gestorben an einem Hungst,
der aus Rache, mit dem Bein
ihn stieß, in das Grab hinein.
Und so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Der Zoologe Thomas H. Gillespie berichtete von dem Maskottbär eines Artillerieregiments, der – ohne dazu abgerichtet worden zu sein, in einer Gefechtssituation ein 15-cm-Geschoss aufhob und sich in die Kette der Munitionsträger einreihte. Ein geniales Pferd, das sich an einem Psychologen rächt, ist dagegen nur eine Kleinigkeit.
Der Schweizer Zoologe Heini Hediger, schrieb dann vor knapp 50 Jahren einmal, dass wir „für das Tier oft in einer für uns unangenehmen Weise durchsichtig“ seien. Und der Primatologe Ray Carpenter, erklärte, wie kompliziert das Leben von Affen ist, die in Bruchteilen von Sekunden einschätzen müssen, ob die Begegnung mit einem anderen Tier gefährlich ist oder nicht, ob es sich um Artgenossen handelt oder nicht, ob es weiblich oder männlich ist, ob es gerade in Hitze ist, ob es alt oder jung ist, ob es zu seiner Gruppe gehört oder nicht. Das alles sind geniale Fähigkeiten, die der gewöhnliche Homo Sapiens gar nicht mehr beherrscht, ohne sein Smartphone zu benutzen. Wir Menschen sind im Vergleich mit dem Verhaltensgenie von Tieren grobe Klötze ohne Sinn und Verstand.
Und ein Planet der Affen ist denkbar. Jeder Hund, jede Katze durchschaut den Menschen. Aber der Mensch? Bleibt sogar sich selbst gegenüber ein großes Rätsel.
ENDE

Szenen einer Ehe – eher eine Szene!
(Urheberrechte und Copyrights © by Michael Kothe)
»Ich liebe dich nicht mehr.«
»Warum sollte es dir besser gehen als mir?« Entgegnete ich. Eine Menge Emotion legte ich in meine Stimme. Auf dieses Gespräch mit ihr hatte ich mich vorbereitet, ich wusste, dass es kommen würde. Kommen musste.
»Du hast mich nie ernst genommen, hast meine Bedürfnisse ignoriert! Für dich war ich nur gut genug zum Putzen und Waschen.«
»Na ja, da war noch ´was anderes«, warf ich ein. Kaum war die Entgegnung über meine Lippen geflossen, bereute ich sie. Ich hatte sie anders gemeint! Innerlich zuckte ich zusammen, sah die moralische Gewitterwolke meinen ganzen Horizont ausfüllen. Prompt erntete ich den Kommentar, den – so schien es mir – jede sexuell frustrierte Ehefrau loswerden musste.
»Der Spruch musste ja kommen, du Pascha. Ihr denkt auch immer nur an das Eine! Und? Was kommt dann? Nur heiße Luft!«
»Stimmt doch gar nicht! Es war echte Liebe, aber im Lauf der Zeit …«
»Etwas Besseres fällt dir auch nicht ein, wenn du mir wenigstens nur ab und zu geholfen hättest. Aber nein, du hattest nur deine Arbeit im Sinn, deine Geschäftsreisen, hast mich und die Kinder vernachlässigt …«
Die Pause war nur kurz, dann wusste ich, was ich zu antworten hatte.
»Ich hab‘s für uns getan. Von nichts kommt nichts.«
»Ach, und meine Arbeit zählt wieder nicht! Ich rackere mich im Haushalt ab von früh bis spät, habe kein Wochenende, keinen Feiertag, keinen Urlaub. Wenn du heimkommst, legst du nur die Füße hoch, erwartest, dass ich dich frage, wie dein Tag war. Wer zum Teufel fragt mich, wie mein Tag war?« Ihre Stimme schwoll ein paar Dezibel an. »Du meinst auch, bloß weil du das Geld heimbringst, …«
»So ist das nicht«, fiel ich ihr ins Wort, »auch wenn ich meine Arbeit nicht gegen deine tauschen möchte, so erkenne ich deine doch an.«
»Und was habe ich davon, tagein, tagaus? Höre ich von dir nur ein einziges Wort der Anerkennung?«
Die Fäuste hatte sie geballt, sie zitterte, ihre Stimme vibrierte. Es war nicht das angenehme Timbre, das ich so lieben gelernt hatte vom ersten Tag an, als wir uns trafen. Aber darauf reagierte ich nicht, es war einfach ihre Stimme, die mich noch immer erregte. Mein Fehler! Als ich meine Gedanken und Sehnsüchte wieder von ihrem Tonfall löste, wusste ich nicht mehr, wie das Gespräch begonnen hatte, das schlechte Gewissen aber blieb. Wie schon so oft. Ich musste mich mehr zusammenreißen! Diesmal ging der Punkt an sie.
Das nächste Streitgespräch ließ nicht lange auf sich warten. Gerade hatten wir noch nebeneinander Hand in Hand auf der Couch gesessen. Nun standen wir uns gegenüber, nach vorn gebeugt, nur der Couchtisch zwischen uns bemühte sich als stummer Schiedsrichter darum, dass der Disput wenigstens einigen Regeln der Vernunft und des Anstands zu gehorchen hatte. Das leidige Thema war der Urlaub im Tessin, im Ferienhäuschen mit dem kleinen Garten, einem Handtuch von Grundstück.
»Nicht einen Finger hast du gerührt! Wenn wir ankommen, räumst du gerade noch das Auto aus. Ist klar, wenn der Wagen erst mal in der Garage steht, kommst du nicht mehr an den Kofferraum. Aber danach …? Ich darf zuerst eine Grundreinigung durchführen, weil das Haus ein halbes Jahr leer stand, während du auf der Terrasse beim Bier eine rauchst und dann im Bett verschwindest. Ja, du hattest ja auch fahren müssen. Aber am nächsten Morgen verlangst du frische Brötchen vom Bäcker, ein geputztes Bad und sämtliche Gartenmöbel auf der Terrasse.«
»Ich habe nie gefordert, dass du das alles in der ersten Nacht herrichtest. Schließlich haben wir fast vier Wochen Urlaub da verbracht.«
»Du hättest ja auch mal zugreifen können! Du weißt auch, wie schwer es mir fällt mit dem alten Rasenmäher.«
»Ja, und am zweiten Tag sollte ich die Hecke schneiden. Das hätte auch Zeit gehabt in den vier Wochen.«
»Wenn es zu Beginn gemacht würde, hätten wir es halt die ganze Zeit schön.«
»Du weißt, wie dringend ich Entspannung gebraucht habe! Immerhin bin ich zehn Monate im Jahr fünf Tage die Woche zwischen zehn und zwölf Stunden von zu Hause fort, während du dir deinen Tag einteilen kannst und deinen Arbeitsplatz gestaltest, wie du ihn möchtest. Während ich fremdgesteuert bin!«
»…?«
Dieser Punkt ging eindeutig an mich.
Das nächste Mal hatte sie mich mundtot gemacht nach nur zwölf Sekunden: »Du hast keine Argumente, du hast nur Ausreden!«
K.O. in der ersten Runde.
Noch einige solche Dispute folgten in der nächsten Zeit. Anfangs mit wechselndem Ergebnis. Dann wurde sie immer stärker, fuhr Themen und Argumente auf, denen ich immer weniger entgegenzusetzen hatte. Sie wurde ruhiger, rationaler, während mich ihre zunehmende Sachlichkeit jedes Mal mehr zur Weißglut brachte. Manchmal wiederholten wir uns. Szenen einer Ehe eben. Dort wird auch nicht alles nur ein einziges Mal aufgetischt, dieselbe schmutzige Wäsche wird mehrmals gewaschen. Sie wurde immer sicherer. Bald hatte sie mich eingeholt. Überflügelt will ich nicht sagen. Oder nicht zugeben.
Und dann:
»Du, danke für deinen Rhetorikunterricht! Du bist ein wirklicher Freund.«
Hannelores Kuss war mehr als gehaucht, er war leidenschaftlich. Genauso leidenschaftlich gab ich ihn zurück. Ich hatte mich lange danach gesehnt.
Mit Hilfe unserer Rollenspiele und ihrem daran gewachsenen Selbstbewusstsein hat sie es geschafft, nicht nur die Scheidung einzureichen und, dem Zerrüttungsprinzip folgend, durchzustehen, sondern sich auch ein übergroßes Stück vom Kuchen der Zugewinngemeinschaft abzuschneiden.
Hannelore und Herbert kannte ich schon lange. Obwohl ich mitgeholfen hatte, ihn zu übervorteilen, tat Herbert mir aus tiefster Seele Leid.
Nach ihrer Scheidung sahen Hannelore und ich uns regelmäßig. Nach einem Vierteljahr verkaufte sie die Wohnung, die ihr zugesprochen worden war, und zog zu mir. Wir heirateten. Nun habe ich sie am Hals und weiß nicht, wie ich sie wieder losbekomme. Im Tessin habe ich die Hecke geschnitten und den Rasen gemäht. Gleich, nachdem ich den Kofferraum ausgeräumt hatte. Sie lag auf der Terrasse im Liegestuhl in der Sonne. Sie wollte für mich hübsch braun werden. Die Brötchen mag sie übrigens warm und mit Kruste, und die Gartenabfälle lasse ich höchstens eine halbe Stunde liegen.
Mit Herbert verstehe ich mich übrigens wieder prima. Im Grunde meines Herzens beneide ich ihn.
ENDE
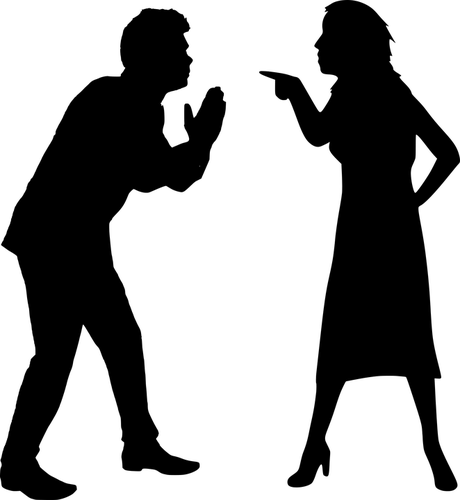
Von Bernhard Horwatitsch
Streifschuss vom 24. März 2021
Anlass: Cancel Culture
Ich bin nicht bedroht! ICH BIN DIE BEDROHUNG!
Seit nun schon längerer Zeit gehöre ich einer der am meisten gehassten Gruppen an, den alten, weißen, heterosexuellen Männern. Und alles, was man über diese Gruppe behauptet, stimmt. Gott sei Dank bin ich wenigstens nicht privilegiert und kaum noch sexuell aktiv. Aber ich bin wütend. Und wütend darüber, dass ich wütend bin. Natürlich verberge ich diese Wut hinter ironischen Klugscheißereien. Wer es mit mir zu tun bekommt, bekommt es mit mir zu tun. Alles, was früher schlecht war, ist heute auch noch schlecht und alles, was früher besser war, ist heute wieder schlecht geworden. Und alles, was heute besser ist, war früher zwar schlecht, aber wen interessiert das? Alle schauen nach vorn. Nur die alten, weißen, heterosexuellen Männer schauen konsequent in den Rückspiegel. Sieht aus, als würden sie vorausblicken, aber es sieht halt nur so aus. Was sieht der alte, weiße, heterosexuelle Mann, wenn er tatsächlich nach vorne blickt? Hängende Klöten ohne Kröten, viel Not ohne Brot und – was dem Zwangsreimen folgt – die Demenz.
Der alte, weiße, heterosexuelle Mann erlebt sehenden Auges seine eigene Verblödung und kann nur hoffen, dass diese Verblödung noch vor der Obdachlosigkeit eintritt. Dann ist er ein dementer, alkoholkranker, alter, weißer, heterosexueller Mann ohne Dach über dem Kopf. Da der alte, weiße, heterosexuelle Mann dement und korsakowerisiert ist, erkennt er seine eigenen Kinder nicht mehr, lebt von der Hand in den Mund auf der Straße und ähnelt zunehmend den Pavianen in Neu-Delhi. Der alte, weiße, heterosexuelle Mann wird zur Affenplage. Sofern sie körperlich noch einigermaßen rüstig sind, greifen sie die friedlichen Passanten auf der Straße an und rauben sie gnadenlos aus. Alles was irgendwie glitzert, zieht sie an. Alles was bimmelt, zieht sie an. Anfangen können sie mit ihrer Beute wenig. Ein primitives Tauschsystem unter den alten, weißen, heterosexuellen Männern funktioniert halbwegs. So werden Essensreste (weggeworfene halbe Döner, Pizzen, Big Macs) gegen Smartphones und Tablets getauscht. Unter den alten, weißen, heterosexuellen Männern gibt es dann wütende Revierkämpfe. Und nicht selten Tote. Sie sehen! Wenn ich jetzt wütend bin und schlechter Laune liegt das ausschließlich daran, dass ich ein alter, weißer, heterosexueller Mann bin.
Von Michael Kothe
Über das Gendern
Liebe Lesende,
liebe Besuchende (dieses Blogs, dieser Kolumne oder wo auch immer dieser Text ans Licht gezerrt wird),
liebe Gendernde,
ich bin einer der Schreibenden. Natürlich, um mich in dieser Disziplin weiterzubilden, auch einer der Lesenden, der Analysierenden und der Beschreibenden. Keiner der Bloggenden bin ich, aber warum sollte ich meine Erkenntnisse nicht dennoch in Form von Rezensionen mitteilen? Auch dabei möchte ich politisch möglichst korrekt sein. Für das Ergebnis stehen Gender-Sternchen*Innen und Gender-Doppelpunkt:Innen. Das ist gut so. Obwohl mir Hähnchen-Innenfilets schmackhafter vorkommen, was ja auch kein Wunder ist, denn immer noch werden männliche Küken geschreddert, und Hähnchenfilets gibt es demzufolge nicht. Und es ist eleganter als ein erstes Gender-Zeugnis aus der IT-Abteilung meiner Behörde, das schon vor Jahrzehnten die Komplexität aufzeigte: »Früher war alles einfacher, da gab es Nutzerbetreuer.
Heute gibt es Nutzerinnenbetreuerinnen und Nutzerbetreuerinnen, Nutzerinnenbetreuer und Nutzerbetreuer.«
Die Problematik zur modernen Vermeidung verbaler Diskriminierung wird auch nicht geringer, wenn sie mit grammatikalischer Geschlechtsumwandlung einhergeht (Zur Abschreckung diene die von der Universität Leipzig 2013 dementierte Anrede »Herr Professorin«!). Vielmehr sollten wir uns auf das (grammatikalische) Geschlecht beispielsweise des Mädchens konzentrieren! Und auf die Vermeidung der daraus resultierenden (grammatikalischen) Fehlerhäufigkeit bei Autor:Innen: »Das ist aber ein hübsches Mädchen! Sie hat so schöne Augen.« Hallo? Also Rückbesinnung auf die Etymologie und konsequenterweise auf die durchgängige Anwendung der Bezeichnung Maid und ihrer Augen? Altertümlich und daher auch nicht wirklich chic.
Zumindest sind Ausdrücke wie Lesende, Besuchende oder Schreibende in Ordnung, wirken sie doch der Separation zwischen Weiblein und Männlein gerade in Zeiten der angestrebten Gleichberechtigung entgegen! In diesem Text habe ich es vorgemacht: Als einer der Schreibenden hebe ich mich nicht von den Kolleginnen der schreibenden Zunft ab, ich analysiere Texte wie jede Rezensentin und unterscheide mich von der Bloggerin nur dadurch, dass ich nicht blogge. Aber … ich sehe gerade: wohin im Singular mit der maskulinen Endung als Lesender oder Schreibender? Ach, da halte ich es doch lieber mit den Richtlinien des britischen öffentlichen Dienstes in seinem Amtsdeutsch, äh, -englisch: »Male embraces female.« *
Und so unterlasse ich die Verbreitung dieser politisch korrekten Gedankenansätze in jeglicher Form. Liebe Lesende, verzeiht, dass ich sie euch vorenthalte!
Michael Kothe, Autor
* »Der Mann umarmt die Frau.« In Anbetracht dieser herzlichen Harmonie ist doch gendermäßig wieder alles in Butter. Oder etwa nicht?
Von Bernhard Horwatitsch

Streifschuss vom 21. Mai 2021
Anlass:
Wozu brauche ich einen Anlass?
Vom Unfug der Gesetze!
Ich weiß nicht mehr, welcher Netflix-Serie ich den Ausspruch verdanke. Er lautet: „Dein Problem ist nicht, dass du zu viele Skrupel hast, dein Problem ist, dass du zu wenig Skrupel hast.“ Skrupel ist ein spitzer Stein und der war im alten Rom die kleinste Maßeinheit für Masse. Ein Skrupel waren etwa 1,25 Gramm. Aus dem Skrupus (spitzer Stein) entwickelte sich das Diminutiv Skrupel und diente ab dem 16. Jahrhundert als Metapher für überängstliches Verhalten, sich sehr vorsichtig über spitze Steinchen zu bewegen. Skrupellose Menschen haben keine Angst, sind frei von Gewissensbissen und daher sehr erfolgreich in ihrem Leben. Die spitzen Steinchen gehen ihnen am Arsch vorbei.
Unser ganzes Rechtssystem ruht auf der falschen Annahme, dass sich der Mensch frei entscheiden könne, ob er eine Missetat ausführt oder nicht. Der in gewisser Weise sehr widerliche deutsche Philosoph Immanuel Kant sah den freien Willen lediglich darin, dass man sich entscheiden kann, sich einer moralischen Instanz unterzuordnen oder nicht. Erst wenn man sich – so Kant – einem sittlichen Gesetz unterwirft, ist man wirklich frei. Das ist ein großer Widerspruch. Denn die meisten erfolgreichen und monetär reichen Menschen unserer Gesellschaft sind erfolgreich und verfügen über einen hohen ökonomischen Status, weil sie genau das nicht tun. Sie unterwerfen sich nicht den sittlichen Gesetzen. Sie machen sie. Kant erschuf ein Sklavenbewusstsein. Doch ich habe Skrupel. Frei bin ich nicht. In meinem ganzen Leben habe ich noch kein Gesetz gebrochen, weder gestohlen, gemordet, betrogen oder für den eigenen Vorteil gelogen.
Gelogen habe ich viel. Und ich habe keine Skrupel, anderen etwas zu erzählen, was nie stattgefunden hat. Doch ich habe große Skrupel, dafür belohnt zu werden. Ich empfinde mein gutes Gedächtnis, das man zum Lügen braucht nicht als einen Vorteil, aus dem ich Gewinn schlagen will. Es ist eher ein Impuls und stark mit dem Lustgewinn verknüpft, den das Lügen selbst auslöst. Daher denke ich, dass Betrüger, Diebe und Mörder auf dieser Grundlage gar nicht anders können, als ihr von Gott gegebenes Talent zu nutzen.
Das ist sehr calvinistisch gedacht. Es gibt Menschen, denen macht es nichts aus, sich ohne zu bezahlen an fremdem Eigentum zu bedienen. Im Gegenteil. Sie folgen einem unwiderstehlichen Drang. Wenn sie ihrem Drang zu stehlen, zu morden oder zu betrügen nachgegeben haben, fühlen sie große Befriedigung und sind glücklich. Unser Gesetz bestraft sie allerdings (wenn man sie erwischt). Doch wäre das Gesetz konsequent, müsste es die belohnen, die nie gestohlen oder gemordet haben. Sie haben genau so frei gehandelt, ginge es nach dem Gesetz. Streng genommen ist das Gesetz also Unsinn. Der Kern unseres Strafrechts ist der so genannte Verbotsirrtum im §17 StGB: Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Konnte der Täter den Irrtum vermeiden, so kann die Strafe gemildert werden. Wir können mit etwas Übung über einen gewissen Zeitraum unsere ureigenen Impulse unterdrücken, umlenken.
Wir können auch rational einsehen, dass es falsch ist, anderen etwas wegzunehmen – sei es ihr Fahrrad oder ihr Leben. Aber wir können das auf Dauer nicht frei entscheiden. Daher ist ein mildes Strafrecht, eine abgemilderte Strafe selbst für den übelsten unter uns gerechtfertigt. Und diejenigen unter uns, die so sehr von ihren Impulsen angetrieben sind, dass sie nicht einmal einsehen können, dass ihr Tun falsch ist, denen gebührt nicht Strafe, sondern Mitleid. Wenn ein narzisstischer, machtgieriger Psychopath (die dunkle Triade, die nach der Psychologie den bösen Menschen ausmacht) ein Verbrechen begeht, dann gebührt ihm unser Mitleid. Ist das nicht Hohn für alle braven Mitbürger? Ja. Aber es ist deshalb Hohn, weil unsere braven Mitbürger, die auch nicht anders können, als eben brav zu sein, dafür nicht belohnt werden. Würde man jedem Mitbürger eine jährliche Prämie auszahlen, wenn er wieder ein Jahr seines Lebens brav war, dann würde aus dem Gesetz ein richtiger Schuh. So aber ist das Gesetz schlicht Unfug. Kant war nur ein starker Pfeife-Raucher, der gar nicht anders konnte, als zu philosophieren. Ihm ein Denkmal aufzustellen ist Unsinn, denn Kant hätte nicht anders gekonnt. Wir Nicht-Philosophen verdienen alle ebenfalls ein Denkmal, weil wir gar nicht anders können, als nicht zu philosophieren.
Wiedersehen in Coronazeiten
(von Michael Kothe)
»Hallo, Heiner!« Er winkt.
Hä?
»Mensch, Heiner, wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Wie geht´s dir?«
Jetzt steht er vor mir, hat im Laufschritt die leere vierspurige Straße überquert.
»Na ja, es muss.«
»Und ´nen Hund hast du auch?«
»Deswegen steh´ ich ja hier draußen. Sonst wär´ ich mit meiner Frau im Supermarkt.«
»Mensch, da ham wir ja Glück gehabt. Gut gemacht, Waldi!« Er bückt sich, krault Mia.
»Du, weißt du noch ...?«, fragt er mich, nachdem er sich wieder aufgerichtet hat.
Mia schüttelt sich.
Nach einer gefühlten halben Stunde dreht er sich im Gehen noch einmal um. »Man sieht sich, war toll, dich mal wieder getroffen zu haben!«
Meine Frau kommt aus dem Laden, schaut ihm nach. »Wer war das?«
»Keine Ahnung«, antworte ich und rücke meinen Mund-Nasen-Schutz zurecht, »er hat mich über die Straße hinweg angerufen. Hallo, Heiner! Hat er gebrüllt.«
»Aber du heißt doch gar nicht Heiner.«
»Doch, mit Maske eben schon!“

Ich sehe euch immer, aber ihr mich meistens nicht
Von Pierre Montagnard
Vom Bahnhof lasse ich mich per Taxi direkt zur Wohnadresse von Marianne und Hannes fahren. Ich habe sie seit 5 Jahren nicht mehr gesehen und wollte das vor meiner Auswanderung nach Südamerika noch machen, ich nehme die Treppe in diesem großen Wohnsilo und gelange an ihre Wohnungstür.
„Nicht angreifen, Kind!“, schreit ein Mann in der Wohnung, als ich gerade an der Haustür klingeln will. Und dann gleich nochmals laut, fast unkontrolliert; „nicht angreifen, Kind!“
Ich hatte nun geklingelt, die Tür geht auf, Marianne, die Frau von Hannes macht auf, begrüßt mich und ruft nach drinnen; „Hannes, der Peter ist da!“
Das war damals, Ende 1990 in Wien.
Als ich drin bin, frage ich Hannes; „sag mal, was habt ihr denn für ein gefährliches Kind, wen wollte es denn angreifen?“ (das Kind, Susi, fünf Jahre alt!).
„Na da, die große Blumenvase!“
„Du meintest wohl, anfassen!“
„Angreifen, Mann! Ihr könnt doch alle kein Deutsch da drüben!“
Ich lache noch heute darüber, vielleicht hatte er sogar recht.
* * * * *
1973 suchte ich in Rosenheim (Bayern) in einem gerade fertig erstellten Rohbau nach einem Mann, namens Horst Mühldorfer. Ich musste ihm ein wichtiges Laborergebnis aus der Schweiz überbringen. Zu Fuß die Betontreppen rauf und runter, durch die noch offenen, rohen Wohnungen, sitzen im vierten Stock drei Männer in blauen Overalls am Boden und nehmen eine Zwischenmahlzeit zu sich.
Gar nicht freundlich werde ich gemustert, mein Sakko und Krawatte passen nicht in ihr Bild und ich sage; „guten Morgen die Herren, wohl bekomms, ich suche nach einem Herrn Horst Mühldorfer, können Sie mir vielleicht weiter helfen?“ Der in der Mitte sagt kurz; „I hob jez mei Brotzeit.“ Daraus schließe ich, dass er der Gesuchte sein muss und sage spontan; krieg I ä wos ap?“ Er glotzt mich an, steht auf, wischt sich die rechte Hand am Overall ab, streckt sie mir hin und sagt; „I wusst jo ned, dass Sie a boayrisch kenna.“
Klar, konnte er nicht wissen, denn im Labor in der Schweiz arbeitete ich über vier Jahre mit einem Münchner zusammen.
* * * * *
Weihnachten im Urwald bescherte uns damals auch echte Zungen- und Gehirn-Wirrungen. Als wir damals ein spätes Mittagessen zubereiteten, fragte Jörg; „Darius könnte doch schon einmal beginnen Kartoffeln und Wurzeln zu schälen.“ „Was willst du denn mit Wurzeln? Sollen wir dafür einen Baum fällen? Fresst ihr denn sowas in Hamburg?“, meint Darius.
Allgemeines Gelächter setzt ein.
„Er meint Rüebli!“ Werfe ich ein, um den Fall zu komplizieren, und Karl Heinz meint, wie wärs denn mit Möhren?“ Darius schaut, wie immer in so Momenten, völlig verunsichert in die Welt und weiß noch immer nicht, wovon die Rede ist. Bruno kommt aus dem Haus und bringt einen Sack Kartoffeln, ein Netz, Karotten und Schabwerkzeug mit. Darius macht große Augen, greift sich an den Kopf und ruft;
„Ihr könnt doch gar nicht richtig Deutsch in Hamburg“, dabei guckt er zu Jörg hinüber. Das Echo von Jörg bleibt nicht aus; „dafür bist du ein Experte in Blasrohren für Indianer!“ Dann guckt Darius noch zu mir und meint; „und ihr da, aus dem kleinen Kanton, habt schon einen Sprachfehler von Geburt auf! Rübli!“
„Rüebli!“, korrigiere ich ihn, „wenn du schon Sprachen lernst, dann achte auf die korrekte Aussprache!“

Karotten Möhren Rüebli Wurzeln
Bei all den erfolgreichen Buchautoren, Filmemachern, Musikern, Künstlern und Unternehmern, sind viele junge Menschen geneigt, ihnen nachzueifern. Sie versuchen, es ihnen gleichzutun und beginnen, das Erschaffene dritter zu kopieren. Das ist der erste Fehlschritt eines Newcomers. Er lässt außer Acht, dass gerade die Erfolgreichen, mit eigener Kreativität zu Werke gingen und deswegen erfolgreich wurden. Deshalb unser Aufruf: Gehe Deinen eigenen Weg, verwirkliche Deine Ideen und erschaffe Deine eigenen Werke.
www.pierremontagnard.com
Jaume Borrell 11, 2/2
08350 Arenys de Mar, Catalunya, Barcelona, España
Tel: ++34 688 357 418 (WhatsApp)
E-Mail: info@pierremontagnard.com
